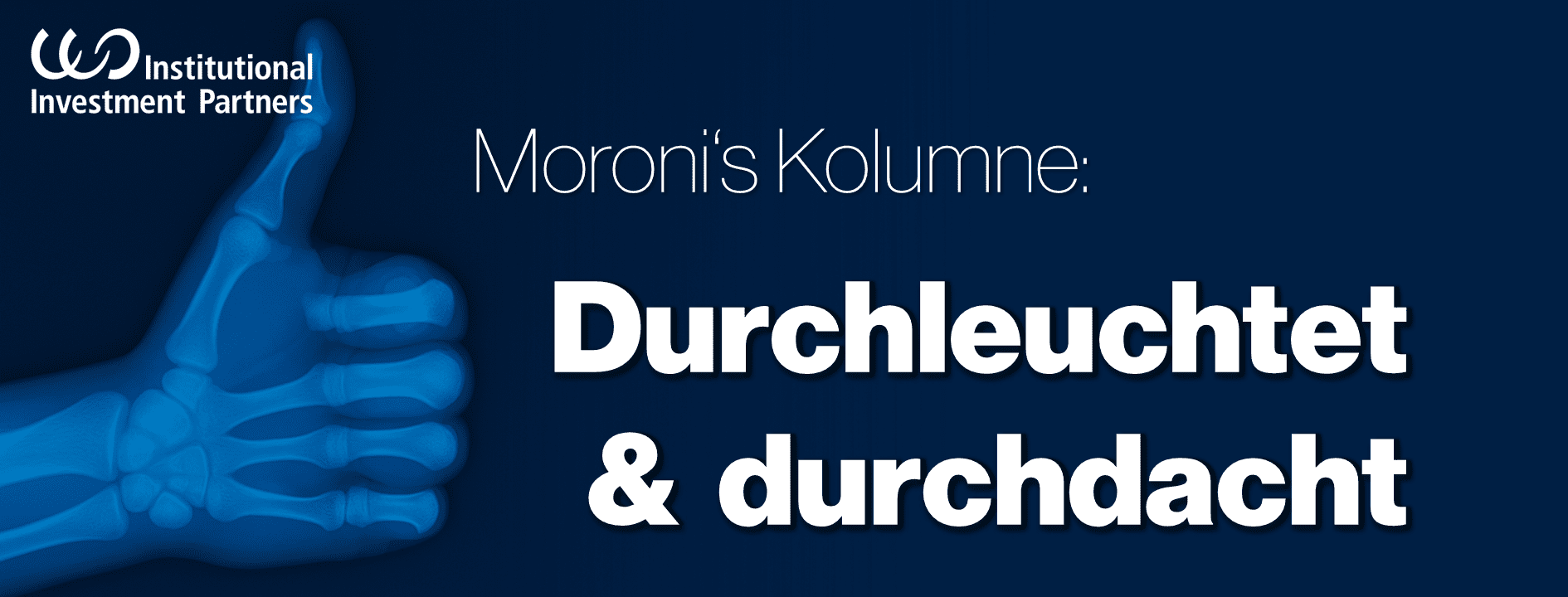
ESG: Wurden wir „vernudged“?
Mit Enthusiasmus begonnen und nun in einer Sackgasse? ESG ist weiterhin richtig – wobei es auf die wertschaffende Umsetzung und Verzielung mit der Fondsstrategie ankommt.
Prügelknabe ESG
Teilweise steht ESG dieser Tage unter starker Kritik, jedenfalls polarisiert ESG gegenwärtig im Kontext regulierter Investmentfonds. Komplexität und Bürokratie, mangelnde Vergleichbarkeit, Datenqualität und Datenverfügbarkeit sind nur einige Stichworte. Das Reizklima hat anscheinend einen Kipp-Punkt überschritten. Und in diesem Reizklima lädt sich die zentrale Frage nach der existentiellen Berechtigung von ESG auf: Inwieweit kann es überhaupt Auftrag professioneller Anleger sein, die Obhut nicht nur für die Kapitalanlage, sondern für Nachhaltigkeits-Themen mit dazu zu übernehmen? Gerne wird nun im Sinne einer ordnungspolitischen Organisation auf die Gestaltungsverantwortung der Politik hingewiesen, die Rahmenbedingungen eigenständig schaffen soll, damit sich die institutionelle Kapitalanlage wieder auf ihren ohnehin anspruchsvollen Kern-Auftrag zurück besinnen kann: Rentable Kapitalanlage.
Von der ESG-Ursuppe in das Dickdicht des ESG-Regulierungs-Schemas
Im Zusammenhang mit Immobilienfonds bestand ESG zunächst aus einer Vielzahl von nicht konzertierten Einzelmaßnahmen. Umfasst waren hiervon zum Beispiel Flächenbegrünungen (Dächer, Vorplätze), Gebäudezertifikate (BREEAM, DGNB, LEED, HQE) oder auch Fondszertifikate (GRESB, ECORE). Diese Maßnahmen wurden vergleichsweise opportunistisch ergriffen, soweit wie sich ihr Einbezug in den Immobilienfonds von Fall zu Fall anzubieten schien.
Daran schloss sich die Phase des Nudging an, losgetreten durch den EU-Aktionsplan 2018, der wenig später in das ESG-Regulierungs-Schema Offenlegungs-VO/Taxonomie-VO mündete. Nudge (englisch für Stups oder Schubs, hier im Sinne von Denkanstoß) ist ein Begriff aus der Verhaltensökonomik, der durch den Wirtschaftswissenschaftler Richard Thaler und den Rechtswissenschaftler Cass Sunstein und deren Buch Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness von 2008, geprägt wurde. Was zum Beispiel in der Unternehmens-Kantine funktioniert (wirklich?), dass dem Kantinenbesucher als zusätzliches Angebot zur ungesunden Curry-Wurst auf gleicher Höhe der Ausgabestelle ein vollwertiges und gesundes Gericht angeboten wird, sollte also nun auf die Fondsindustrie übertragen werden. Anleger sollten einen Nudge bekommen, bei einer Vielzahl von Produkten sich nicht nur mit Heißhunger auf die Rendite zu stürzen. Sie sollten beginnen, ihre Produktauswahl auch auf Nachhaltigkeitszutaten zu basieren.
Mit dem Nudging wusste man anfangs noch nicht recht gut umzugehen. Schubsen an sich sollte kein Problem sein, wenn hierfür nicht tausend Vorgaben der Regulatorik zu beachten wären. Das Regulierungs-Schema war kompliziert, nicht im Detail seiner Verflechtung zu Ende gedacht, im ständigen Fluss der Überarbeitung, wobei wiederum individuelle Ergänzungen der lokalen Aufsichten dazukamen. Die Verlagerung von der Problem- auf die Chancen-Fokussierung in der Industrie ändert sich unvermittelt und schlagartig. Und zwar ist dies auf den Zeitpunkt zurückzuführen, als sich der bei regulatorisch besonders anspruchsvollen Problem manchmal noch mehr als die Rechtsabteilung interessierte Vertrieb des Themas annahm. Hieraus entwickelten sich mannigfaltige Ansätze nach der Offenlegungs-VO, die sich in Zahlen als 6, 8 und 9 ausdrücken lassen. Die damit garnierten Produkt-Verpackungen wurden anfänglich gerne angenommen, wobei es bereits anspruchsvoll genug schien, die damit verbundene Erreichung – messbarer (!) – Nachhaltigkeitsmerkmale darzustellen oder echte Nachhaltigkeitsrisiken zu mitigieren. Als Kernfrage für den Entscheider der professionellen Immobilien-Kapitalanlage verblieb aber trotzdem die legitime Frage: Wie stark zahlt die Verpackungs-Etikette selbst überhaupt auf die eigentliche Fondsstrategie ein? Ist mit der Verpackung ein – zumindest die Kosten übersteigender – ökonomischer Nutzen für das Kapitalanlageergebnis verbunden?
Rückbesinnung auf messbare Nachhaltigkeitsziele wie CO2
Die EU-Initiative FIT FOR 55 fokussiert den Kern der Bemühungen nun wieder auf die schnellst mögliche Reduzierung des CO2 Footprint von Gebäuden gegen die Klimakrise. Sicherlich nicht zufällig entwickelte es sich dabei zum Standard, dass – soweit die Daten verfügbar sind – Immobilien-Bestände anhand des Dekarbonisierungspfads von CRREM gemessen werden. Marktstandards als Grundlage für Investoren-Reportings – wie das BVI-Dachfonds-Reporting-Template – sammeln diese Daten bereits längst ein und ermöglichen eine zuverlässige Darstellung. Durch den Einbezug des Gebäude-Sektors in das Zertifikate-System ergeben sich effektiv Lenkungswirkungen für nachhaltiges Handeln, wie sie kaum ein Design eines Artikel-8-Fonds setzen könnte.
Fazit – Strategie schlägt Fondsverpackung
ESG spielt weiterhin eine wesentliche Rolle im Immobilienfondsbereich, wobei Nachhaltigkeitsstrategien in Zukunft vermutlich noch besser mit der Fondsstrategie und dem Interesse auch an ökonomischen Nutzen zusammengebracht werden.
Daraus folgt:
- Gute Messbarkeit der Strategie, wenn sie insbesondere auf die CO2 -Reduktion direkt abzielt
- CO2 ist zunehmend ein preisbildender Faktor in der Immobilienbewertung („Ticket-Preis für CO2“)
- Anleger verbinden Nachhaltigkeitsziele sehr gut mit ihren eigentlich im Kern ökonomischen Interessen an einer profitablen Kapitalanlage, ohne sich sich in regulatorischen Details verlieren zu müssen
Das hilft, schwierig zu handhabende Komplexitäten zu reduzieren, und führt zu einer Rückbesinnung auf für die Nachhaltigkeit und Rentabilität messbare Ergebnisse.





