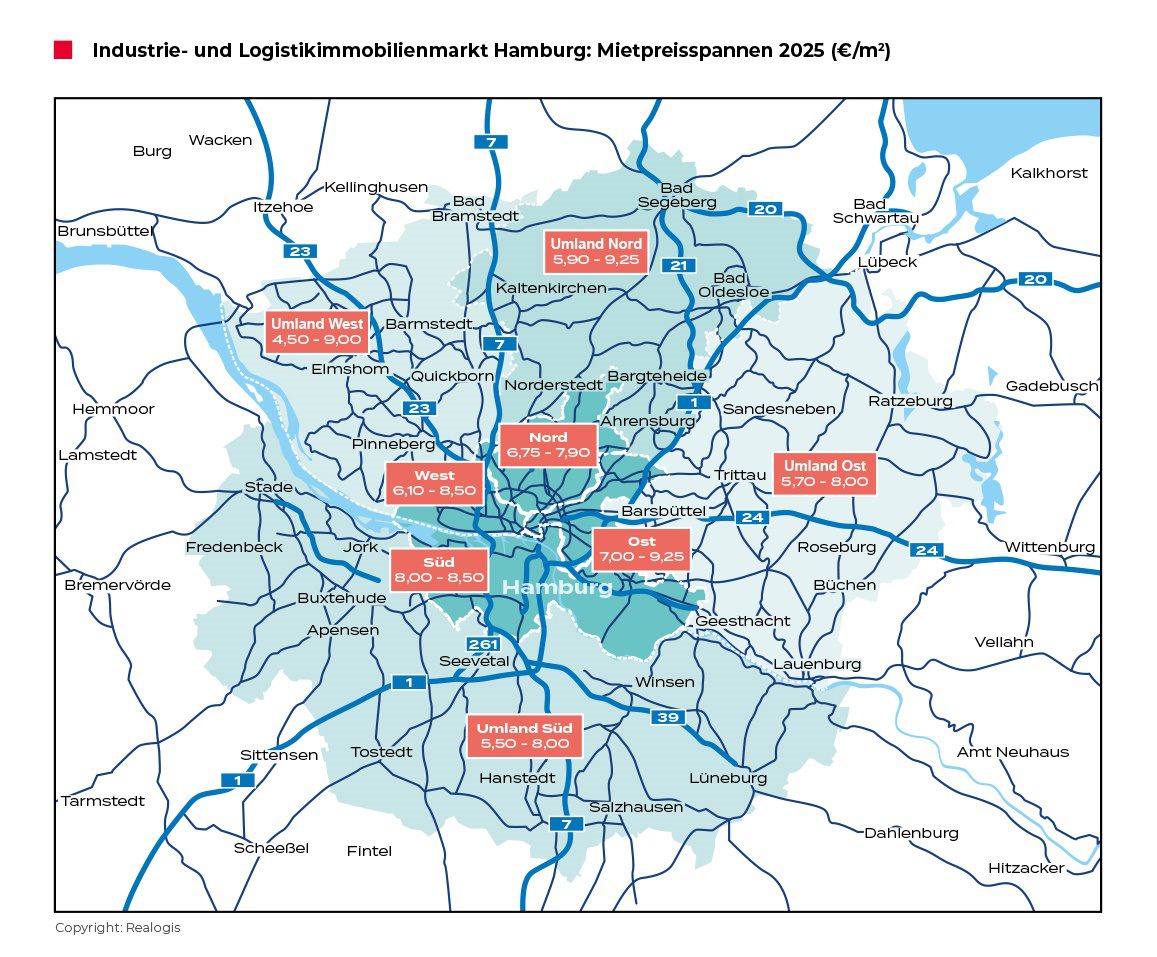Nach über einem Jahrzehnt ungebrochener Aufwärtsbewegungen ist der deutsche Büroimmobilienmarkt in eine Phase der Stagnation eingetreten. Die Zinswende der EZB, die geopolitischen Folgen des Ukrainekrieges sowie eine fragile Weltwirtschaft haben seit 2022 zu einer deutlichen Abkühlung geführt. Für Investoren und Asset Manager bedeutet dies, dass Planbarkeit und Cashflow-Sicherheit – einst verlässliche Konstanten – zunehmend in Frage stehen.
Vom Boom zur Blockade
Die Jahre 2010 bis 2021 waren geprägt von einem nahezu linearen Wachstum: Niedrige Finanzierungskosten, stabile gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen und eine hohe Flächennachfrage stützten lange Mietvertragslaufzeiten und sicherten Eigentümern wie Nutzern gleichermaßen Planungssicherheit. Steigende jährliche Transaktionsvolumina im Bürosegment und Spitzenmieten, die in München, Berlin oder Frankfurt neue Rekorde erreichten, waren die Folge.
Dieses Modell stößt nun an Grenzen. Unternehmen, die in den Boomjahren Expansion als Selbstverständlichkeit ansahen, sehen sich mit multiplen Unsicherheiten konfrontiert: steigende Zölle im transatlantischen Handel, Rezessionstendenzen in Deutschland und Europa, schwache Nachfrage in wichtigen Exportmärkten. Strategische Unternehmensplanung reduziert sich in vielen Fällen auf kurzfristige Reaktionsmuster.
Das schlägt direkt auf den Flächenmarkt durch: Die aktuellen Flächenumsätze sanken um 25-30% gegenüber den Höchstwerten 2021. Gleichzeitig stieg der Leerstand in Städten wie Frankfurt oder Düsseldorf auf über 8 %, was die Marktteilnehmer zusätzlich verunsichert.
Differenzierte Nachfrageprofile
Während Headquarter-Standorte großer DAX-Konzerne bislang relativ stabil bleiben – oftmals auch, weil repräsentative Gebäude Teil der Markenidentität sind –, geraten monolithisch geprägte Großflächen besonders in peripheren Lagen unter Druck.
So reduzieren Telekommunikationsanbieter, Versicherungen oder Krankenkassen ihren Flächenbedarf systematisch. Teilweise durch Effizienzprogramme, teilweise, weil hybride Arbeitsmodelle weniger physische Präsenz verlangen. Hinzu kommt die Unsicherheit, wie sich der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz auf die Mitarbeiterzahlen auswirken wird.
Beispielhaft sei ein großer Versicherer genannt, der in einer süddeutschen Großstadt seinen Campus schrittweise um über 30 % verkleinert. Statt in langfristige Mietbindungen einzutreten, prüft er flexible Satellitenbüros in zentralen Lagen, um Mitarbeitern zwar Präsenzflächen zu bieten, gleichzeitig aber die Fixkosten im Zaum zu halten.
Für Eigentümer bedeutet dies: Der einstige Gleichlauf von langfristiger Cashflow-Sicherheit und stabiler Nutzerplanung ist aufgebrochen. Nutzer suchen Flexibilität, Eigentümer wollen Sicherheit – ein Zielkonflikt, der den Markt lähmt.
Finanzierbarkeit als Nadelöhr
Neben den Nachfrageseffekten sind die Finanzierungskonditionen ein zentraler Belastungsfaktor. Büroimmobilien, die in der Boomphase zu Spitzenrenditen von unter 3 % handelten, sehen sich heute Finanzierungskosten von 4 bis 5 % gegenüber. Viele Transaktionen sind schlicht nicht mehr darstellbar, ohne dass Verkäufer massive Wertabschläge akzeptieren. Das erklärt, warum das Investmentvolumen 2024 mit rund 5 Mrd. Euro im Bürosegment den niedrigsten Stand seit über zehn Jahren markierte. Gegenüber dem Jahr 2021 bedeutet dies ein Rückgang von ca. 80%.
Für institutionelle Investoren entsteht dadurch ein Dilemma: Einerseits ist das Segment traditionell das Rückgrat des Gewerbeimmobilienmarktes – über 40 % aller gewerblichen Transaktionen entfallen regelmäßig auf Büros. Andererseits erfordern steigende Zinskosten ein Umdenken in der Strukturierung, Laufzeitgestaltung und Risikoverteilung von Mietverträgen.
Lektionen aus der Produktion: Auslastung vor Bindung
In der Industrie hat sich stets bewährt, Produktionskapazitäten bestmöglich auszulasten. Übertragen auf die Immobilienwirtschaft hieße dies: Eigentümer müssen stärker bereit sein, sich den ökonomischen Rahmenbedingungen ihrer Nutzer anzupassen.
Kürzere Vertragslaufzeiten und flexible Modelle, mit einer Flexibilitätsprämie, könnten es ermöglichen, Flächen schneller wieder in den Markt einzuspeisen – und zugleich die Bilanzbelastungen der Mieter zu reduzieren, da langfristige Mietverpflichtungen IFRS-bedingt als Verbindlichkeiten wirken.
Das Argument der Eigentümer, dass kurze Laufzeiten mit höheren Cashflow-Risiken verbunden seien, ist nicht von der Hand zu weisen. Doch dieses Risiko kann teilweise kompensiert werden:
Marktpreisanpassungen bei Vertragsverlängerungen oder Neuvermietungen werden bislang oft unterschätzt. Ausbaukosten lassen sich durch Rückbau-Pönalen oder standardisierte Ausbaulösungen in den Griff bekommen. Hybridmodelle, die Grundflächen langfristig absichern, aber Expansionsflächen mit flexibleren Modellen koppeln, könnten eine Brücke schlagen.
Fungibilität als unterschätzter Faktor
Ein oft übersehener Aspekt ist die Fungibilität von Büroimmobilien: In guten Lagen mit hoher Standortqualität bleibt die Wiedervermietbarkeit auch bei kürzeren Vertragslaufzeiten attraktiv. Der Preis für ein vollvermietetes Objekt in einer Toplage hängt daher nicht ausschließlich von der Restlaufzeit (WALT) ab, sondern stark von Lagequalität, Drittverwendungsfähigkeit und Managementkompetenz.
Professionelle Asset Manager kalkulieren bewusst mit Nachvermietungsszenarien und trauen sich zu, Flächen flexibel wieder in den Markt zu bringen. Ein kurzer Mietvertrag in einer Bestlage kann daher unter Rendite-Risiko-Aspekten attraktiver sein als ein langer Mietvertrag in peripherer Lage mit unsicherer Nachfrage.
Langfristiger Engpass bleibt
Bei aller derzeitigen Tristesse darf eines nicht übersehen werden: Büroimmobilien sind nachfrageseitig eng an die Wirtschaftsleistung gekoppelt. Sobald die Konjunktur wieder anzieht, steigt auch der Flächenbedarf. Die Produktionsseite – also die Entwicklung neuer Büroflächen – ist jedoch träge, teuer und von Genehmigungsprozessen geprägt. Bis eine neue Immobilie marktfähig ist, vergehen oft fünf bis sieben Jahre.
Das bedeutet: Nach Schwächephasen können deutliche Preisanstiege auftreten, wenn das Angebot nicht mehr die Nachfrage bedienen kann. Diese zyklische Volatilität ist eine Konstante des Büroimmobilienmarktes – und sie ist ein Argument, weshalb sich gerade jetzt antizyklische Engagements lohnen können.
Zwischen Sicherheit und Anpassung
Die gegenwärtige Stagnation am Büroflächenmarkt ist weniger Ausdruck fehlender Nachfrage als vielmehr das Ergebnis eines strukturellen Misfits zwischen Eigentümer- und Nutzerinteressen. Auf der einen Seite Investoren, die auf langfristige Cashflows angewiesen sind – sei es aus Finanzierungsgründen oder regulatorischen Vorgaben. Auf der anderen Seite Unternehmen, deren Planungsunsicherheit zu flexiblen, bilanziell leichteren Lösungen drängt.
Nur wenn es gelingt, diesen Widerspruch mit neuen Vertragsmodellen, höherer Flächenanpassungsfähigkeit und einem realistischen Blick auf geopolitische wie technologische Risiken zu überbrücken, kann der deutsche Büroimmobilienmarkt die Lähmung der letzten drei Jahre überwinden.
Der nächste Zyklus wird kein Selbstläufer mehr sein – aber er könnte einer sein, der durch mehr Flexibilität, professionelle Nachvermietungsstrategien und eine neue Partnerschaft zwischen Nutzern und Eigentümern resilienter ausfällt als je zuvor.

Ein nachhaltiger Marktansatz erfordert, Kapazitäten effizienter und flexibler zu nutzen