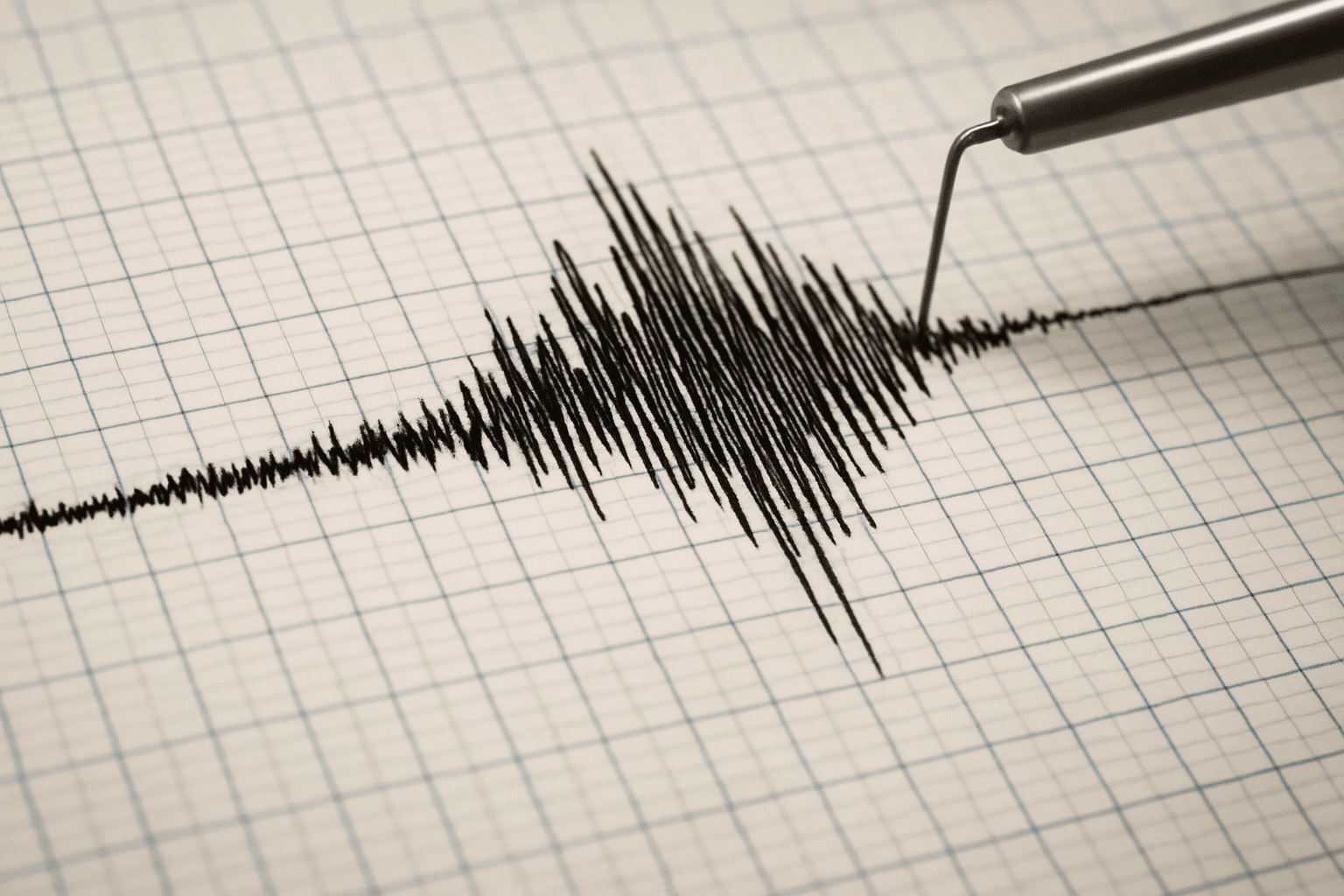Angesichts steigender Zinsen und volatiler Märkte suchen institutionelle Investoren verstärkt nach alternativen Anlageformen. Genussscheine bieten dabei zahlreiche Vorteile – insbesondere bei Immobilien- und Infrastrukturprojekten.
Genussscheine entwickeln sich zunehmend zu einem attraktiven Instrument für institutionelle Investoren, die abseits klassischer Finanzierungsmodelle nach höherer Rendite und struktureller Flexibilität suchen. Besonders bei Immobilien- und Infrastrukturinvestments lohnt sich ein genauer Blick auf diese Beteiligungsform, auch wenn sie mit höheren Risiken einhergeht.
Bei Immobilieninvestitionen werden Genussscheine üblicherweise von einer Zweckgesellschaft emittiert, die Immobilieneigentümerin ist. Der Investor stellt über die Zeichnung Kapital bereit – für Ankauf, Sanierung oder Erweiterung. Die Gesamtfinanzierung erfolgt meist über drei Ebenen: vorrangiges Fremdkapital, nachrangige Anleihen und Genussscheine, die bilanziell als Eigenkapital gelten und im Insolvenzfall zuletzt bedient werden.
Die Nachrangigkeit führt zu einem erhöhten Risiko, das jedoch durch die Chance auf deutlich höhere Ausschüttungen kompensiert wird. Neben der Verzinsung profitieren Anleger bei Genussscheinen auch von Sondererträgen und Verkaufserlösen. Typisch ist ein Renditevorsprung von drei bis vier Prozentpunkten gegenüber Anleihen. Findet eine fundierte Bewertung des Investments und seiner Risiken sowie eine kontinuierliche, professionelle Begleitung während der Laufzeit statt, können die höheren Risiken realistisch eingeschätzt werden, sodass sie im Rahmen der Gesamtinvestition gut darstellbar sind.
Flexibilität als Trumpf
Ein weiterer, zentraler Vorteil von Genussscheinen ist ihre Flexibilität: Ausschüttungen können variabel gestaltet und das Volumen gestaffelt eingebracht werden. Auch die Laufzeit lässt sich anpassen. Zwar ist sie üblicherweise an die geplante Haltedauer der Immobilie gekoppelt. Sollte sich das Marktumfeld gegen Ende dieses Zeitraums jedoch als ungünstig erweisen, kann die Laufzeit verlängert werden. Zudem ist ein vorzeitiger Exit möglich, wenn sich Emittentin und Investor einig sind. Und nicht zuletzt können Anteile an andere Kapitalgeber übertragen werden.
Auch bei der aufsichtsrechtlichen Einstufung können Genussscheine vorteilhaft sein: In der Anlageverordnung gelten sie als Wertpapiere und fallen in der Regel unter Quote 9 – anders als Direktinvestitionen in Immobilien, die unter Quote 14 erfasst werden. Institutionelle Investoren können dadurch Immobilienengagements ausweiten, ohne die zulässige Immobilienquote zu überschreiten.
Mobilisator für privates Kapital
Der Einsatz von Genussscheinen ist nicht auf Immobilien beschränkt. Auch Infrastrukturprojekte – etwa aus den Bereichen erneuerbare Energien, Verkehr, Bildung oder Digitalisierung – profitieren von dieser Finanzierungsform. Die öffentliche Hand ist bei vielen dieser Projekte auf private Finanzierungspartner angewiesen. Genussscheine können das private Kapital als eigenkapitalähnliche Komponente mobilisieren – bei gleichzeitig hoher Bonität der Projektpartner und langfristig planbaren Erträgen.
Der Überblick zeigt: Als eigenkapitalähnliches Finanzierungsinstrument können Genussscheine eine sinnvolle Ergänzung zu bestehenden Kapitalstrukturen darstellen. Denn mit ihnen können institutionelle Investoren auf mehrere Arten profitieren – von höheren Renditen, flexiblen Strukturen und regulatorischen Vorteilen. Die Vorteile gehen zwar mit einem höheren Risiko als bei klassischen Anlageformen wie Aktien oder Anleihen einher. Bei sorgfältiger Analyse und professionellem Management lässt sich dieses Risiko aber gut einordnen und steuern – und Genussscheine werden zum lohnenden Renditetreiber im Portfolio.