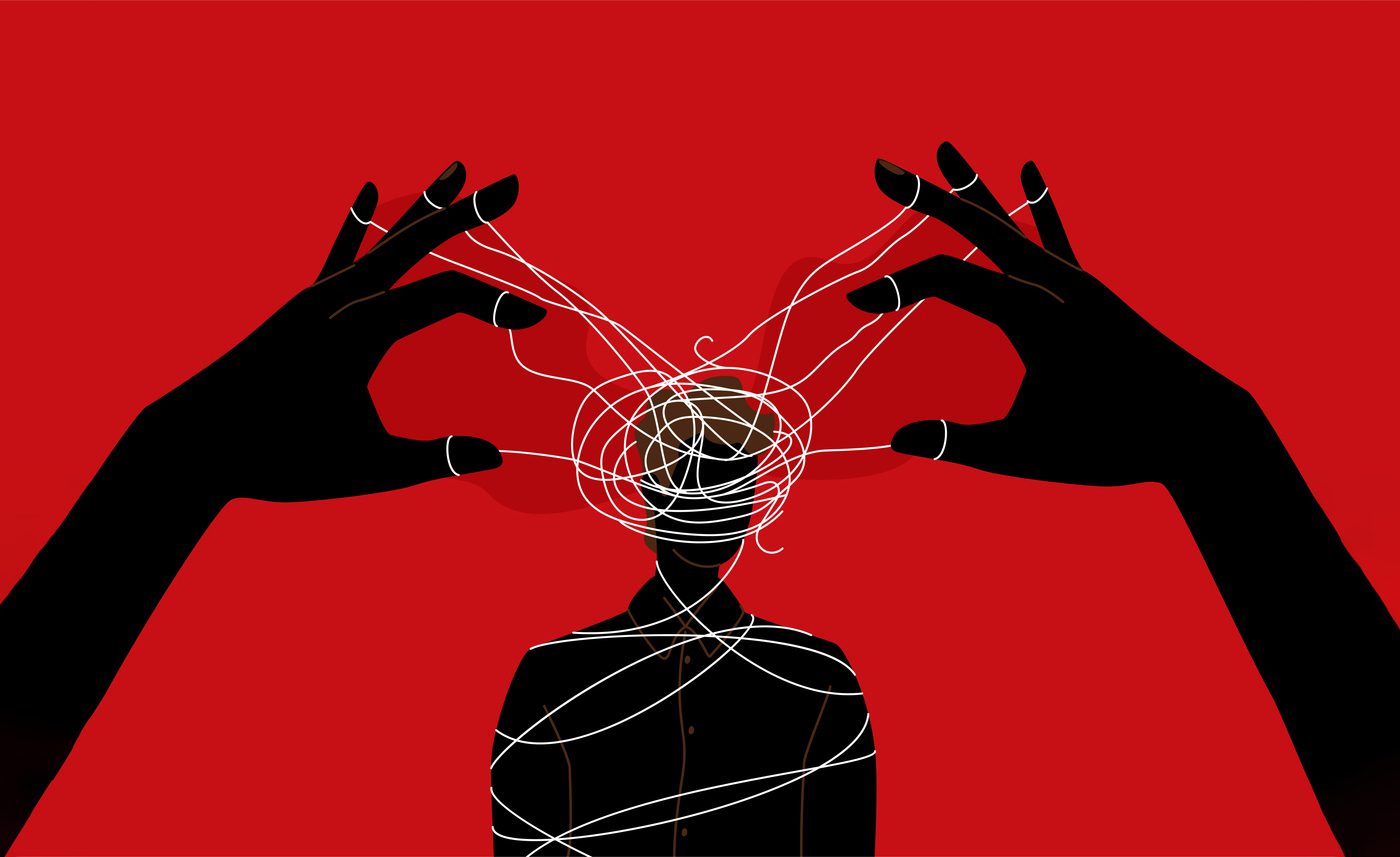Staatliche Haushaltskonsolidierung ist ein hehres Ziel, doch – wie schon Bertolt Brecht in einem anderen Zusammenhang feststellte – „die Welt ist halt nicht so“. Die Welt bleibt aber auch nicht so, wie sie jetzt ist. Daher müssen sich Märkte darauf einstellen, dass ein altes Gespenst, wahrscheinlich zuerst in den USA, wieder auftauchen könnte: Financial Repression mit zusätzlichen außenwirtschaftlichen Elementen, abgeleitet aus den „Mar-a-Lago-Accord“-Überlegungen.
Die Vereinigten Staaten von Amerika befinden sich aktuell in einem Shutdown, weil es der Regierung bislang nicht gelungen ist, einen Haushalt für das Fiskaljahr 2026 oder zumindest einen Übergangshaushalt durch das Parlament zu bringen. Eine der Stolperschwellen ist sicherlich, dass ungeachtet aller Wahlkampfversprechen die Projektionen für die Staatsschulden ein ungebremstes Weiterwachsen derselben vorhersagen. Trotz gestiegener Zolleinnahmen bewegt sich das jährliche Defizit nahe an der 2-Billionen-US-Dollar-Marke, 2.000 Milliarden US-Dollar also, und selbst wenn 400 Milliarden Zolleinnahmen jährlich tatsächlich dauerhaft erzielt werden können, wirken diese nicht wie eine Lösung, allenfalls eine Abminderung. Das jährliche Defizit dürfte weiterhin zwischen fünf und sechs Prozentpunkten der Wirtschaftsleistung liegen, in einer Zeit ohne Rezession.
Die USA stehen nicht alleine da. In Frankreich sind in den letzten 15 Monaten die Regierungen Barnier, Bayrou und Lecornu damit gescheitert, einen Haushalt für 2026 zu verabschieden, welcher das Defizit nachhaltig unter die 5-Prozentmarke drücken würde und im zweiten Versuch hat Lecornu bereits angekündigt, die Rentenreform erst mal bis zum Jahr 2028 auf Eis zu legen. In Japan führten vorsichtige Sparansätze zum Rücktritt des Premierministers, in Deutschland hat man es erst gar nicht versucht und das Vereinigte Königreich wechselt seine Finanzminister schneller als seine Regierungschefs.
Gründe für neue Staatsausgaben sind schnell gefunden: Die Infrastruktur ist teilweise marode, Energiewende und -sicherheit erfordern staatliche Unterstützung, Verteidigung ist derzeit erste politische Priorität und vieles mehr.
Aber kann das denn jetzt einfach so weitergehen? Die Antwort ist ein klares Nein, jedenfalls nicht für alle.
Wichtiger als die absolute Höhe der Neuverschuldung ist die Höhe der laufenden, respektive der akkumulierten Verschuldung zur Wirtschaftsleistung, standardmäßig mit dem Sozialprodukt gemessen und die Zinsbelastung, die diese Verschuldung für den Staatshaushalt mit sich bringt. Die Wissenschaftler Carmen Reinhardt und Kenneth Rogoff haben in einem vielbeachteten Buch von 2011 „This Time is different“ unter anderem argumentiert, dass jenseits einer Schwelle von 90 Prozent akkumulierter Staatsverschuldung zum Sozialprodukt die staatliche Handlungsfähigkeit auf dem Spiel steht. Die definierte Höhe der Quote wurde in heftigen Diskussionen danach hinterfragt, auch was die methodische Herleitung betrifft und später flexibler interpretiert. Kern bleibt aber, dass der Staat mit zunehmender Verschuldung an Handlungsfähigkeit verliert und es politischer Kraftakte bedarf, aus dieser Situation wieder herauszukommen. Die Verschuldung hat sich in den letzten 15 Jahren dramatisch erhöht, nicht nur absolut, sondern auch relativ zur Wirtschaftsleistung und mittlerweile liegt der Großteil der industrialisierten westlichen Staaten eher im dreistelligen Bereich der Verschuldungsquoten.
Während im zweiten Jahrzehnt dieses Jahrtausends diese ökonomischen Fehlentwicklungen durch die Niedrigzinsphase (in einigen Ländern wie Deutschland sogar eine Negativzinsphase) überdeckt wurden, ist diese Phase mit dem Inflationsschub und dem Rückkehr zu normaleren Zinsverhältnissen seit einigen Jahren vorbei.
Für die Reduzierung dieser Staatsschuldenquoten gibt es Handlungsoptionen, die sich allerdings in der Schwierigkeit der politischen Durchsetzbarkeit unterscheiden.
Zum einen könnte man direkt an den beiden Seiten des Haushaltes ansetzen: Höhere Steuern oder niedrigere Ausgaben sind direkte Entscheidungen, um die Budgets ausgeglichener zu gestalten. Aber man muss sie durchhalten. Und bei allen zwei bis vier Jahre stattfindenden Wahlen sind die Anreize für Politiker, dies zu tun, gering. Zu lang ist die Liste derjenigen, die mit dem Versuch, staatliche Bilanzen zu konsolidieren, ihr politisches Ende eingeläutet haben.
Am liebsten genommen, weil wenn erfolgreich, auch für die Popularität von Politikern am besten, ist der Weg über höheres Wachstum. Höheres Wachstum schafft höhere Steuereinnahmen und auch niedrigere Sozialausgaben und damit einen Beitrag zur Milderung der Verschuldungssituation von zwei Seiten: Budgetkonsolidierung und Anstieg der Wirtschaftsleistung. Das ist momentan in den USA der Fokuspunkt der neuen Administration. In Europa kann ich dagegen wenig Konzepte zur Wachstumsförderung erkennen, das Wachstum wird de facto über zusätzliche Staatsausgaben und Defizite auf Pump finanziert. Die Wachstumsstrategie ist aber nur erfolgreich, wenn zum einen das nominale Wachstum höher ist als das Wachstum der Neuverschuldung. Zudem müssen die durch höheres Wachstum ausgelösten Nebenwirkungen unter Kontrolle gehalten werden, damit die höheren Steuereinnahmen durch Wachstum nicht durch höhere Zinskosten für die aufgestaute Verschuldung aufgefressen werden.
Financial Repression als Wundermittel?
Das öffnet die Tür zur zumindest auf den ersten Blick „schmerzfreien“ Lösung für die politischen Entscheidungsträger: Financial Repression. Der Begriff ist nicht neu, er ist auch nicht eineindeutig definiert. Je nach Autor kann man ein breites Bündel an Maßnahmen dazuzählen. Am wichtigsten ist, dass über verschiedene Maßnahmen Zinsen für die Staatsschulden niedriger gehalten werden, als sie es bei reinen Marktkräften wären, insbesondere die Realzinsen. Die relativen Finanzierungskosten des Staates werden damit künstlich gedrückt, der Preis ist eine unauffällige, sanfte, schleichende Verminderung des Realvermögens, respektive Deckelung des Vermögenswachstums, das aus nominellen Zinsanlagen resultiert.
Genauso wenig wie der Begriff Financial Repression eindeutig definiert ist, gilt das für die damit verbundenen Maßnahmen.
Das kann durch Kapitalverkehrskontrollen passieren (wobei diese eher „outdated“ sind), durch kontinuierliche Anleihekäufe der Notenbank, oder manchmal reichen auch anvisierte Kaufprogramme. Dazu oder alleine kann auch eine aktive „Yield Curve Control“ kommen, das heißt, dass die Notenbank die Zinsen über die gesamte Renditekurve nach oben deckelt. Banken und Versicherungen können über Regulierungsvorschriften „incentiviert“ werden, Anleihen des jeweiligen Nationalstaates zu kaufen (Liquiditäts-, Solvency-Regeln, Kapitalanrechnung und ähnliches). Manche Autoren rechnen auch eine Veränderung der als geldwertstabil akzeptierten Inflation der Notenbank zu diesen Maßnahmen dazu, die zumindest indiziert, dass Geldentwertung in einem begrenzten Ausmaß erwünscht ist, also zum Beispiel von dem standardisierten 2-Prozentziel in Richtung 3 bis 4 Prozent akzeptierter Inflation.
Ziel ist es, den möglichen negativen Folgen einer Wachstumspolitik, nämlich den höheren Zinsen, entgegenzusteuern und de facto eine schleichende Entwertung der Staatsschulden zu bewerkstelligen und damit staatliche Handlungsfähigkeit wiederherzustellen. Hier handelt es sich nicht um einen einmaligen Kraftakt, sondern um eine längerfristig angelegte Operation.
Die Historie kennt verschiedene Phasen der Financial Repression. Da sind zum einen die Jahrzehnte nach dem Ende des 2. Weltkrieges in den USA, als das relative Ausmaß der Staatsverschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung über eine Kombination von erhöhter, aber nicht dramatisch erhöhter Inflation, gedeckelter Zinsen und hohem Wachstum sukzessive zurückgeführt wurde. Diese Phase dürfte auch die Begriffsgebende sein.
Eine andere Periode, die nahe an eine Financial Repression herankam, war die Periode nach dem Lehman-Desaster und dem Platzen der Housing/Subprime Bubble in den USA, in Europa akzentuiert durch die Staatsschuldenkrise insbesondere in der europäischen Peripherie. Allerdings sprang im Vergleich zur Financial Repression nach dem 2. Weltkrieg in den USA die Inflation nicht an. Gerade in Europa „kompensierten“ disinflationäre Tendenzen nach der Lehman-Pleite die Effektivität einer Financial Repression. Wissenschaftler und Politiker, unter anderem der bereits genannte Kenneth Rogoff argumentierten, man müsse das Bargeld abschaffen, um den Notenbanken deutlich negativen Kurzfristzinsen und damit die Financial Repression zu ermöglichen.
Nicht jede Phase, in der die Nominalzinsen unter der Inflation liegen, kann als Financial Repression deklariert werden. Dafür muss es auch Handlungen staatlicher Institutionen geben. Was aber allen Phasen der Financial Repression gemein ist: Die Notenbank muss mitspielen, um richtig erfolgreich zu sein.
Damit kommen wir zum Schlüssel des Themas. Die derzeitige US-Administration scheitert an der versprochenen Haushaltskonsolidierung. Diese Regierung dürfte aber ohne Frage über das Thema der Financial Repression nachdenken, wie das Hochheben des sogenannten dritten FED-Zieles der moderaten Langfristzinsen zeigt. Dieses dritte Ziel hatte man in der Vergangenheit als Resultat der ersten beiden angesehen. Ich denke, Stephen Miran, Berater von Präsident Trump, aber derzeit temporär im FED-Board, sieht es eher sehr eigenständig und als Mittel zum Zweck (der Reduzierung der Zinskosten). Sollte der Oberste Gerichtshof die Zölle als unrechtmäßig in Teilen oder zur Gänze verwerfen, dann wird natürlich die Administration versuchen, mit neuen Begründungen sie wieder einzuführen. Aber das Thema Financial Repression mag dann sogar noch zusätzlich an Dynamik gewinnen.
Wenn es ohne Notenbank nicht geht, muss die auch mitspielen. In den USA dürfte Jerome Powell das nicht tun. Dies mag auch eine zusätzliche Erklärung für die Angriffe sein, die auf ihn gefahren werden und es unterstreicht die Wichtigkeit der Entscheidung über den neuen FED-Chair, die Präsident Trump für den Mai des Jahres 2026 zu treffen hat (bekanntgegeben wahrscheinlich um die Jahreswende). Nicht auszuschließen, dass tatsächlich auch ein Verfechter der De facto-Financial Repression auf den Posten gehievt wird, das wird eine der Schlüsselentscheidungen des Jahres 2026 werden. Eine aggressive Form der Financial Repression ist aus meiner Sicht in jedem Fall eine mögliche Variante, nicht mein Base Case, mit der man sich in der Amtszeit von Donald Trump beschäftigen muss.
Was bedeutet das für die Märkte?
Ich habe im Bezug auf die geopolitischen Krisen dieser Welt öfters ausgeführt, dass Kapitalmärkte keine moralische Instanz sind, sondern ein Mechanismus, der der Preisfindung verschiedener Assets dient. Financial Repression ist ohne Zweifel wirtschaftspolitisch und moralisch fragwürdig, weil sie gerade die Ersparnisse des „kleinen Mannes“ negativ trifft.
Aber Financial Repression muss nicht negativ sein für alle Assetklassen, insbesondere auf kurze und mittlere Sicht (und, ich zitiere Keynes, „in the long run we are all dead“). Es gibt Assetklassen, die gerade in der Anfangsphase einer Financial Repression davon profitieren können und, sollte eine Financial Repression von den USA ausgehen, gibt es sicherlich auch verstärkte regionale Effekte.
Kommen wir zunächst zu den augenfälligen Verlierern einer solchen Politik, und da lässt sich ziemlich platt sagen, dass die Herstellung künstlich zu niedriger Realzinsen dem klassischen, auf Sicherheit bedachten Staatsanleiheinvestor höhere Returns verwehrt. Aber auch hier zeigt sich, da es kein festgeschriebenes Drehbuch gibt, wie eine Financial Repression laufen würde, dass der Teufel im Detail liegt. Man muss genau schauen, was gemacht wird und was nicht. Sind Käufe auf die ganze Zinsstrukturkurve oder nur das kurze Ende fokussiert? Wird eine Yield Curve Control etabliert und bezieht sie sich auf mehrere oder wenige Stützstellen? Eine Yield Curve Control kann dem Anleger auch die Risiken eines Zinsanstieges für die Periode der Financial Repression nehmen, das ist nicht viel, aber unter Risikogesichtspunkten immerhin etwas. Ohne Yield Curve Control wird sicherlich das Risiko bestehen, dass eine Politik der Financial Repression zu einer noch steileren Renditestrukturkurve am Rentenmarkt führt.
Kommen wir zu möglichen Gewinnern: Höhere Inflation entwertet das Geld, eine Financial Repression, die nur eine moderat höhere Inflation zulässt, ist aber nicht gefährlich für das Wirtschaftswachstum und kann für die Bewertung von realen Assets wie Immobilien oder Aktien durchaus preisstimulierend sein. Financial Repression kann damit durchaus die Attraktivität von Risikopapieren zu Lasten derer von sicheren Anlagen erhöhen. Reale Assets wie Aktien, Private Equity, Infrastruktur, Immobilien profitieren also zunächst, sind aber auch abhängig von weiteren staatlichen Maßnahmen, denn der Staat betreibt ja nur dann Financial Repression, wenn er auf der Suche nach Einnahmen ist.
Bei der gegenwärtigen US-Administration kommen noch weitere Komponenten dazu. Die Gedankengänge eines Teiles des neuen ökonomischen Teams waren schon im Vorfeld ideologisch unterlegt worden: MAGA auf der einen Seite, aber auch die Vorstellung, dass die USA von den Handelspartnern ausgenutzt wurden und insofern „Pay-Back Time“ anstehen würde. Und vieles, was von diesen Gedanken gefloatet, aber noch nicht umgesetzt wurde, hört sich für mich nach einer Financial-Repression-Erweiterung an, mit einer Komponente an, die nur auf Nicht-US-Investoren zielt. Einige Ideen waren angeteasert (zum Beispiel Section 899, Abgaben auf Gewinne von Fonds in den USA, Gedankenspiele um freiwillige Laufzeitenverlängerungen), andere werden tatsächlich erzwungen, wie Investments in den USA, die vielleicht nicht aus Effizienzgründen, sondern aus Angst vor Sanktionen zugesagt werden (Beispiele: Pharmaindustrie, Chipindustrie).
Im Hintergrund wabert sozusagen die Idee eines Mar-a-Lago-Akkords, der die ultimative Financial Repression für Anleger in den USA diskutiert hatte: Eine massive Dollarabwertung. In heimischer Währung für US-Bürger ein Non-Event, für US-Unternehmen eine Gewinnspritze, für Unternehmen außerhalb der USA in deren heimischer Währung das Gegenteil, für den Rest der Welt eine effektive Vermögensminderung. In den Abhandlungen über den Mar-a-Lago Akkord war die Dollarschwäche erst im späteren Verlauf der Amtszeit Trump angedacht, aktuell scheint es mir aber nicht das Hauptthema zu sein. Wenn man aber über die Möglichkeiten der Realisierung eines solchen Szenario nachdenkt, dann gehört es auf alle Fälle zum Baukasten. Für mich ist die Prognose des Dollarkurses sogar eine Schlüsselkomponente eines jeden Szenarios für das kommende Jahr.
Europas Möglichkeit zum Gegensteuern in einem solchen Szenario wäre limitiert. Die institutionellen Begrenzungen der Eurozone würden greifen: Es gibt eben nicht nur eine Regierung und eine Zinskurve. Eine Yield Curve Control in der Eurozone müsste sich dann auf viele große Bondmärkte gleichzeitig konzentrieren.
Damit ist ein Fokus des Anlegers auf das Thema Financial Repression ausgehend von den USA als Risikoszenario zwingend. Es würde, ceteris paribus, eher einen Impuls geben in Richtung reale Assets, es würde insbesondere einen Impuls geben in Richtung liquide reale Assets in den USA, das Bild für reale Assets in Europa wäre gemischt, aber es würde eher positiv für europäische Bonds wirken. Financial Repression wäre also ein Szenario, das die Länderallokation in den Vordergrund rücken würde.