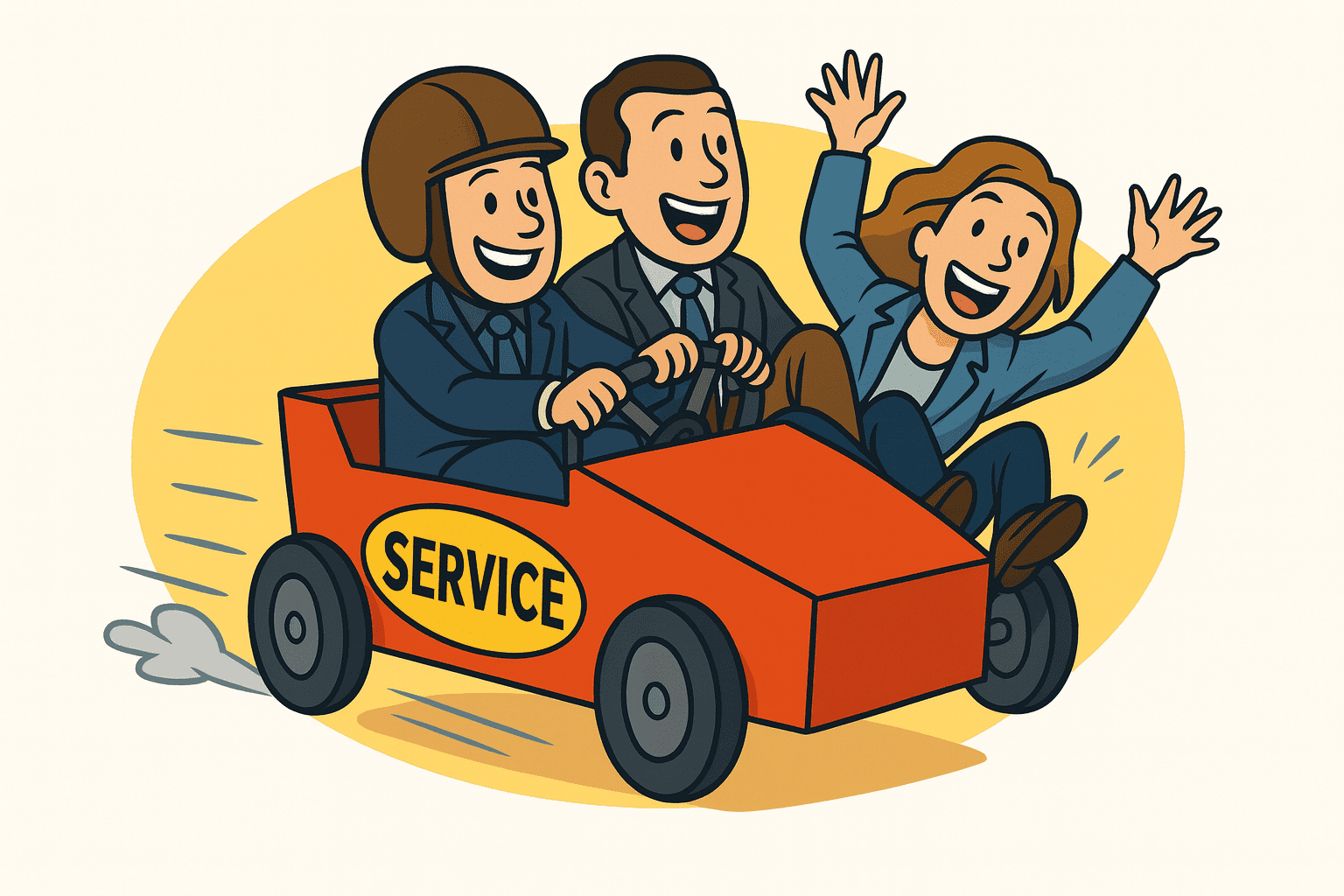Mit dem Fondsrisikobegrenzungsgesetz (FoRiBeG) will der Gesetzgeber die Governance im Fondsbereich verbessern. Herzstück ist der neue § 27 Abs. 4a KAGB:
Künftig müssen Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG), die Fonds auf Initiative Dritter auflegen oder verwalten, der BaFin detailliert darlegen, wie sie Interessenkonflikte identifizieren, verhindern, managen und offenlegen.
Das klingt nach einem Fortschritt – und ist es formal auch.
Nur: Adressieren Richtlinien wirklich die eigentlichen Ursachen von Interessenkonflikten? Oder liegen diese nicht tiefer – in den Geschäftsmodellen und ihren Anreiz- und Machtverhältnissen?
Vom Verhaltenshandbuch zur Governance-Frage
Der Referentenentwurf zum FoRiBeG steht in der Linie einer Systemkonvergenz von KVGen zu Kreditinstituten (vergleiche auch die Kolumne vom 15. August 2025).
Er verschärft insbesondere die Verhaltens- und Organisationspflichten, indem er die allgemeine Norm des § 27 KAGB um einen neuen Absatz 4a ergänzt.
Damit soll sich – stark verkürzt – eine Rechtsgrundlage für einen in der Industrie weit verbreiteten Anwendungsfall finden:
Wenn eine KVG einen Fonds auf Initiative eines Dritten auflegt, soll sie künftig dokumentieren, welche Schritte sie unternimmt, um Interessenkonflikte zu erkennen, zu managen, zu überwachen und ggf. offenzulegen. Laut Begründung dient das der Umsetzung der überarbeiteten AIFMD- und OGAW-Vorgaben.
Formal also ein Handbuch gegen Interessenkonflikte.
Aber: Kann man ein Strukturproblem mit Handbüchern lösen?
Plattform-KVGen: Service und Master als Unterformen
In der Fondsindustrie, die stark nach den Prinzipien der Economies of scale organisiert ist, haben sich sogenannte Plattform-KVGen etabliert.
Grob lassen sich zwei Unterformen unterscheiden:
- Service-KVG
- Stammt ursprünglich aus dem Wertpapiergeschäft (Private-Label-Fonds) und wurde nach regulatorischen und verwaltungsaufsichtsrechtlichen Entwicklungen Mitte der 2000er auf den Immobilien-Bereich adaptiert,
- der Initiator (Asset Manager) bringt die Idee, den Vertrieb und das Management,
- die Plattform-KVG stellt die Erlaubnis, die Administration, das Risikomanagement und den regulatorischen Rahmen,
- sie soll formell beaufsichtigen, ist aber wirtschaftlich abhängig vom Initiator.
- → Ein klassisches Prinzipal-Agent-Problem: Der „Agent“ (KVG) kontrolliert den „Prinzipal“ (Initiator), wie es übrigens im Fall von Verwahrstellen dem Gedanken nach auch besteht.
- Master-KVG
- wird typischerweise von institutionellen Anlegern selbst initiiert,
- der Asset Manager ist nicht Initiator, sondern Dienstleister („Operator“) auf der verlängerten Werkbank der Anleger,
- organisatorisch ähnlich, aber mit anderer Interessenkonstellation.
Diese arbeitsteiligen Modelle sind betriebswirtschaftlich sinnvoll und in der Industrie etabliert –
aber sie bergen inhärente Interessenkonflikte, die sich nicht einfach wegrichtlinien lassen.
⚡ Operative Prozessfragen statt Papierberge
Natürlich ist es sinnvoll, Interessenkonflikte transparent zu machen.
Nur: Mehr Papier führt nicht automatisch zu mehr Macht der Anleger.
Die Aufsicht kann Richtlinien prüfen, aber kaum rekonstruieren, wer tatsächlich Einfluss auf einzelne Entscheidungen genommen hat.
Aus Anlegerperspektive sind daher weniger Handbücher als vielmehr Geschäftsmodelle und ihre Anreizstrukturen zu verstehen und kritisch zu hinterfragen.
Denn auch wenn Plattform-KVGen formal als Treuhänder den Anlegern verpflichtet sind, ergeben sich Interpretationsspielräume bei der Ausübung dieser Treuhänderschaft — und diese werden viel stärker durch das Geschäftsmodell geprägt als durch Compliance-Richtlinien.
Drei thematische Beispiele:
- Bewertung
Wer prägt die Bewertungspolitik des Fonds und steuert faktisch die Bewerter einschließlich des Bewertungs-Prozesses?
Das ist nicht nur für NAVs relevant, sondern auch für Transaktionspreise und Vergütungsmechanismen. - Unabhängigkeit von Asset Managern
Gibt die Plattform den Anlegern belastbare Leistungsversprechen?
Wer hält die Datenhoheit, um bei einem (erzwungenen) Managerwechsel Kontinuität sicherzustellen? - Exit
Gibt es Hürden, die es Anlegern erschweren, den Fonds sauber zu verlassen?
Der Exit muss bereits bei Zeichnung im Fondsvertragswerk abgesichert sein – danach ist es oft zu spät.
📌 Ergebnis
- Interessenkonflikte in Service- und Master-KVG-Strukturen lassen sich nicht allein durch Richtlinien „wegverwalten“ – weil sie im Geschäftsmodell selbst angelegt sind.
- Relevanter als Compliance-Ordner sind die dahinterstehenden rechtlichen Konstrukte zwischen Anlegern und KVGen.
- Positiv: Nach Beendigung des letzten Immobilienzyklus zeigt sich, dass viele institutionelle Anleger inzwischen die nötige Vorbildung besitzen, um die unterschiedlichen Interessenlagen von Plattform-KVGen differenziert einzuordnen.
📝 Kurz: Nicht Richtlinien wahren Anlegerinteressen –
sondern nur eine klare Sicht auf Geschäftsmodelle, Anreize und Machtverhältnisse.