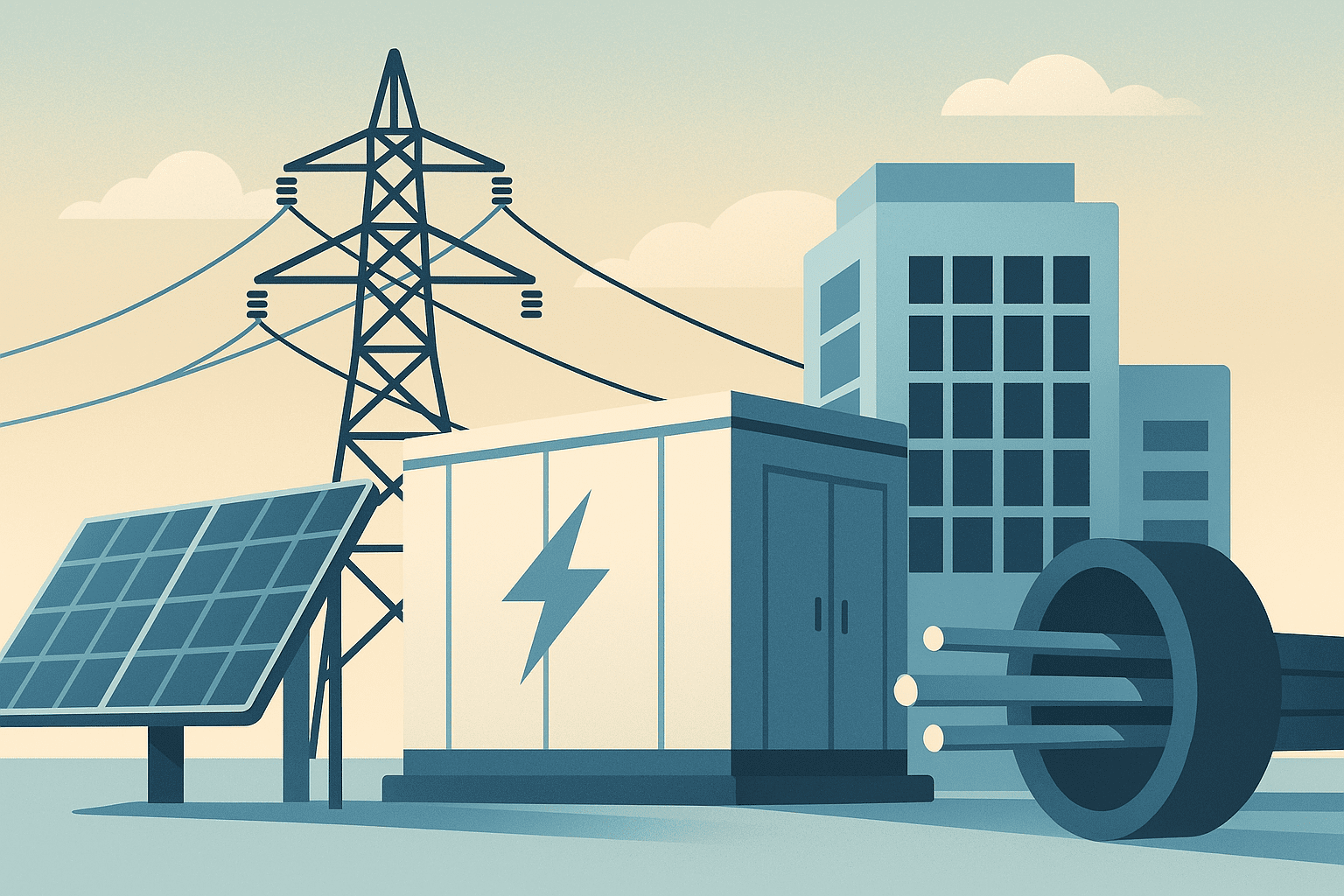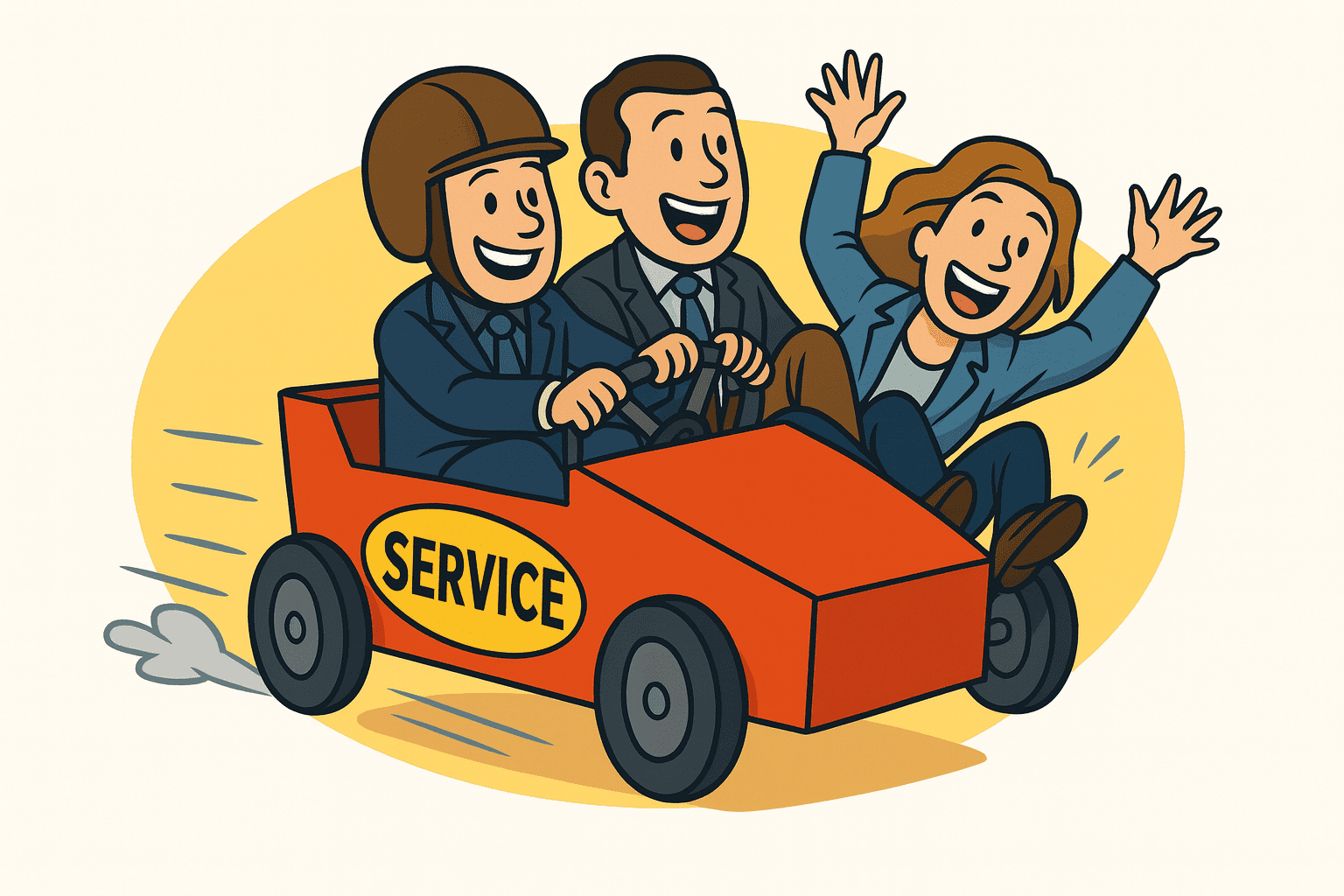Die Kapitalverwaltungsgesellschaft NordVest GmbH arbeitet derzeit gemeinsam mit FinanceConnect – einem Gemeinschaftsunternehmen der Energieforen Leipzig GmbH, Versicherungsforen Leipzig GmbH und der Pine Valley Capital GmbH – an der Konzeption des NV Infrastrukturfonds I zur Unterstützung der Energiewende. Ziel ist es, insbesondere Stadtwerken und kommunalen Unternehmen langfristig Eigenkapital zur Verfügung zu stellen, um zentrale Infrastrukturprojekte im Bereich Strom- und Wärmenetze, Speicherlösungen, Gastransformation sowie Wasserinfrastruktur und Erzeugung zu finanzieren.
Im Zentrum des Vorhabens steht die Sicherstellung der kommunalen Daseinsvorsorge bei gleichzeitiger Finanzierungsfähigkeit der Unternehmen und „Wende-Projekten“ gegenüber Banken und institutionellen Investoren.
Aus unseren Erfahrungen vieler Gespräche mit Institutionellen Investoren und Stadtwerken lassen sich einige zentrale Herausforderungen ableiten.
Hierzu zählen aus Sicht der Versorgungsunternehmen:
- Sicherstellung, dass alle Stadtwerke und Versorgungsunternehmen gleichermaßen die Möglichkeit haben auf Gelder des Energiewendefonds zugreifen zu können
- Gründung von Projekt- und Zweckgesellschaften sollte durch die Kommunalaufsicht nicht gebremst werden und Unternehmen dazu befähigt werden
- In regulierten Geschäftsbereichen müssen Eigenkapitalrenditen so attraktiv sein, dass Institutionelle Investoren bei vergleichbaren Infrastrukturen und Risikoprofilen gerne in Deutschland investieren und Versorgungsunternehmen in der Lage sind die EK-Kosten über die Regulierungsvorgaben zurückzuverdienen.
Aus Sicht der Kapitalgeber ist klar:
- Investitionen, ob in Form von Eigen- oder Fremdkapital, erfordern klare Abgrenzungen und Würdigung bzw. angemessene Vergütung der Risiken.
- Institutionelle Investoren wünschen eine möglichst „sortenreine“ Verwendung der eingesetzten Mittel in Übereinstimmung mit den für sie geltenden regulatorischen Vorgaben (je nach Investorengruppe: Anlageverordnung, VAG, Solvency etc.). Kapitalgeber wollen gezielt in Energiewendeprojekte investieren – nicht jedoch in andere kommunale Aufgabenfelder wie Bäderbetriebe. Die Lösung liegt in der Projektgesellschaftsstruktur: „Wenn Stadtwerke bereit sind, ihre Investitionen in klar abgegrenzte Projektgesellschaften zu führen, wird aus Bankensicht die Bonitätsprüfung nicht auf das Stadtwerk, sondern auf die Cashflows des jeweiligen Projekts abgestellt. Zudem können in die Projekte weitere Investoren eingebunden werden, die lediglich Einfluss auf das Projekt haben möchten, aber nicht auf die Aktivitäten des Stadtwerks.“
- Grundsätzlich vergleichen Investoren jedes Investment mit den Standardgeldanlagen, wie z.B. dem Kauf einer Bundesanleihe, welche ein hohes Rating, einen festen Kupon und tägliche Veräußerbarkeit bietet. Jedes Investment muss sich damit vergleichen lassen.
- Höhere Ertragsschwankungsrisiken oder Rückzahlungsrisiken, längere Kapitalbindung bzw. Nicht-Handelbarkeit sowie ein höherer interner Aufwand, um das Finanzprodukt zu verstehen und später die Performance zu überwachen, muss durch entsprechende Absicherungsstrukturen sowie eine höhere Ertragserwartung berücksichtigt werden. In diese Ertragsanforderungen spielen auch die auf Seiten der institutionellen Investoren geltenden regulatorischen Mindestertragsvorgaben (Rechnungszins) und Eigenkapitalhinterlegungsvorschriften hinein.
- Langfristige Finanzierbarkeit der kommunalen Unternehmen kann u.a. dadurch sichergestellt werden, dass Assets und Infrastrukturservices in speziellen Projektgesellschaften geführt werden, um die Bilanzen zu entlasten und Finanzierungsspielräume auszuweiten
Von Seiten der Regulierungsbehörden für die Energie- und Finanzwirtschaft sollten entsprechend positive Rahmenbedingungen gesetzt werden. #BNetzA #BAFIN #BMWE
Hier sehen wir die folgenden Handlungsfelder:
Branche benötigt eine dezentrale und flexible Fondsarchitektur mit hoher Reaktionsfähigkeit
Deshalb schlagen wir vor, den geplanten Energiewendefonds als Dachstruktur mit klar definierten Kriterien für untergeordnete Teilfonds auszugestalten, die ihrerseits über Fördermittel oder Garantien verfügen können, um zusätzliche private Mittel zu mobilisieren. Mit diesen Fördermitteln, Garantie oder First-Loss-Pieces wird privat initiierten Fonds der Einstieg und die Mobilisierung privater Gelder (Versicherungen/Pensionskassen) erleichtert oder überhaupt erst ermöglicht. Untergeordnete Fonds sollten aus bereits bestehenden Fonds und Organisationen zur Verfügung gestellt werden, um schnelle Handlungsfähigkeit sicherzustellen.
Gleichberechtigter Zugang zu Kapital aus EWF ist unabdingbar
Die deutsche Energiewirtschaft ist, und das trifft in besonderem Maße auf die Mitgliedsunternehmen des VKU zu, durch eine dezentrale und vielschichtige Struktur geprägt. Die Realität zeigt, dass viele Investitionen der Stadtwerke innerhalb überschaubarer Zeit und mit verhältnismäßig kleinen Beträgen umgesetzt werden. Eine zentralisierte Vergabestruktur würde diese Dynamik ausbremsen. Diese Charakteristika müssen sich in der Struktur zur Vergabe von Mitteln über den Energiewendefonds widerspiegeln. Dies bedeutet, dass ein solcher Fonds, oder ihm anhängende Intermediäre, in der Lage sein müssen Eigenkapital für Projekte im sechsstelligen Bereich zu vergeben. Dies kann nur durch eine dezentrale Struktur erfolgen, in der Intermediäre, wie z.B. NV FinanceConnect Infrastrukturfonds Kapital oder Risikoübernahmen zur Verfügung gestellt werden, die diese privatwirtschaftlich effizienter investieren können.“
Eine zentrale Organisation des EWF wird zu einer Konzentration von Kapital bei großen und sehr großen Akteuren der Branche führen. Wir sind überzeugt, dass ein gleichberechtigter Zugang aller kommunalen Akteure – unabhängig von Größe und Region – zu Fördermitteln und Garantien des Energiewendefonds zentral für das Gelingen der Energie-, Wärme-, Mobilitäts- und Wasserwende ist. Gerade diese Unternehmen decken die Vielzahl der projektspezifisch und lokal bzw. regional erforderlichen Sachkenntnis ab und realisieren die notwendigen Transformationsprojekte flächendeckend und praxisnah vor Ort.
Beachtung vielschichtiger Anforderungen von Investoren
Eine bestmögliche Transparenz über den Erfolg des investierten Kapitals lässt sich über Zweckgesellschaften darstellen, die von Stadtwerken als Tochtergesellschaften für den Bau und Betrieb von Projekten zu gründen sind. Wesentliche Vorteile sind klar abgrenzbare Risiken für die Stadtwerke und Investoren, eine Kreditgewährung basierend auf den Cashflows und damit auch ein geringerer Einsatz von teurem Nachrangkapital. Hierfür ist es nötig, dass kommunale Unternehmen bundesweit einheitlich unbürokratisch und schnell solche Gesellschaften gründen können und keine zusätzlichen Hürden der Kommunalaufsicht überwinden müssen im Vergleich zu privatwirtschaftlichen Unternehmen. Auch lassen sich für die Unternehmenslenker Blaupausen schaffen, die rechtliche und organisatorische Umsetzung erleichtert und interne Hürden abbaut.
Ertragssicherung für (teil-)regulierte Geschäftsfelder
Die Erträge, welche die regulierten Unternehmen als Nutzer der zur Verfügung zu stellenden Investmentmittel, als Kapitalerträge im Sinne einer Verzinsung zahlen können, sind durch die Regulatorik weitgehend vorgegeben. Während sich die Fremdkapitalkosten weitestgehend an den am Markt verfügbaren Konditionen für das jeweilige Unternehmen orientieren, sind bei der Eigenkapitalrendite nationale Berechnungslogiken zugrunde gelegt. Für die Allokation von Investorengeldern wäre es allein im europäischen Vergleich notwendig, die EK-Renditen zu erhöhen. Wenn dies in der breite bei der aktuellen Diskussion als schwierig anzusehen ist, wäre es eine veritable Option die Rendite an den Transformationsimpakt hin zu einer Kohlenstofffreien Wirtschaft zu koppeln und einen Renditeaufschlag für Projekte der Taxonomieklassen 8 und 9 vorzusehen.
Alternativen zur Ertragssicherung für regulierte Unternehmen
Die Erträge, welche die regulierten Unternehmen als Nutzer der zur Verfügung zu stellenden Investmentmittel, als Kapitalerträge im Sinne einer Verzinsung zahlen können, sind durch die Regulatorik weitgehend vorgegeben. Eine Ertragssteigerung der Versorgungsunternehmen, um höhere Kapitalkosten zu bedienen, scheint schwierig bis ausgeschlossen. Damit das Zusammenfinden von festen verfügbaren Zahlungsströmen durch die kommunalen Unternehmen an die risikoorientierte Rendite der Finanzinvestoren erleichtert werden kann und ggf. überhaupt ermöglicht wird, benötigen wir Instrumente, durch deren Beimischung deutlich günstigerer Kapitalkosten, insbesondere hinsichtlich des Nachrangkapitals, erreicht werden können.
Eine Option ist Eigenkapital aus dem Sondervermögen zu nutzen, das als First-Loss-Piece beim Kapital der privatwirtschaftlichen Fonds wirkt. Die Einbringung dieses First-Loss-Pieces reduziert die Risikoprämie der privatwirtschaftlichen Investoren deutlich. Alternativ könnte auch eine First-Loss Garantie des Bundes ohne Kapitalbindung zur Verfügung gestellt werden. Erfolgreiche Beispiele dazu gibt es bereits innerhalb der KfW bei Mikrofinanzfonds (KfW wie beim EFSE oder Green for Growth Fund).
Neben direkten Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen bieten sich zinsverbilligte und/oder Darlehen mit Haftungsfreistellung (ähnlich der KfW-Förderdarlehen) an. Diese unterstützen durch Hebelung die Erträge an die Finanzinvestoren. Zudem bietet sich eine Unterstützung im Hinblick auf das Risikoprofil an. Je geringer das Ertragsschwankungs- bzw. Ausfallrisiko der Investments beurteilt wird, desto eher sind die Investoren bereit, einen geringeren Kapitalertrag zu akzeptieren. Denkbar sind hier Bürgschaften oder Garantien sowie Co-Investments, welche Anteile etwaiger Risiken zuerst abfangen.
Die skizzierte Ausgestaltung des Energiewendefonds bietet eine einmalige Chance, die Investitionsfähigkeit kommunaler Unternehmen nachhaltig zu sichern und institutionelles Kapital für die Daseinsvorsorge zu mobilisieren. Ein flexibler, dezentraler Fondsrahmen – kombiniert mit gezielten Risikoabsicherungsmechanismen – schafft die Grundlage für eine tragfähige Finanzierungsarchitektur der Transformation.