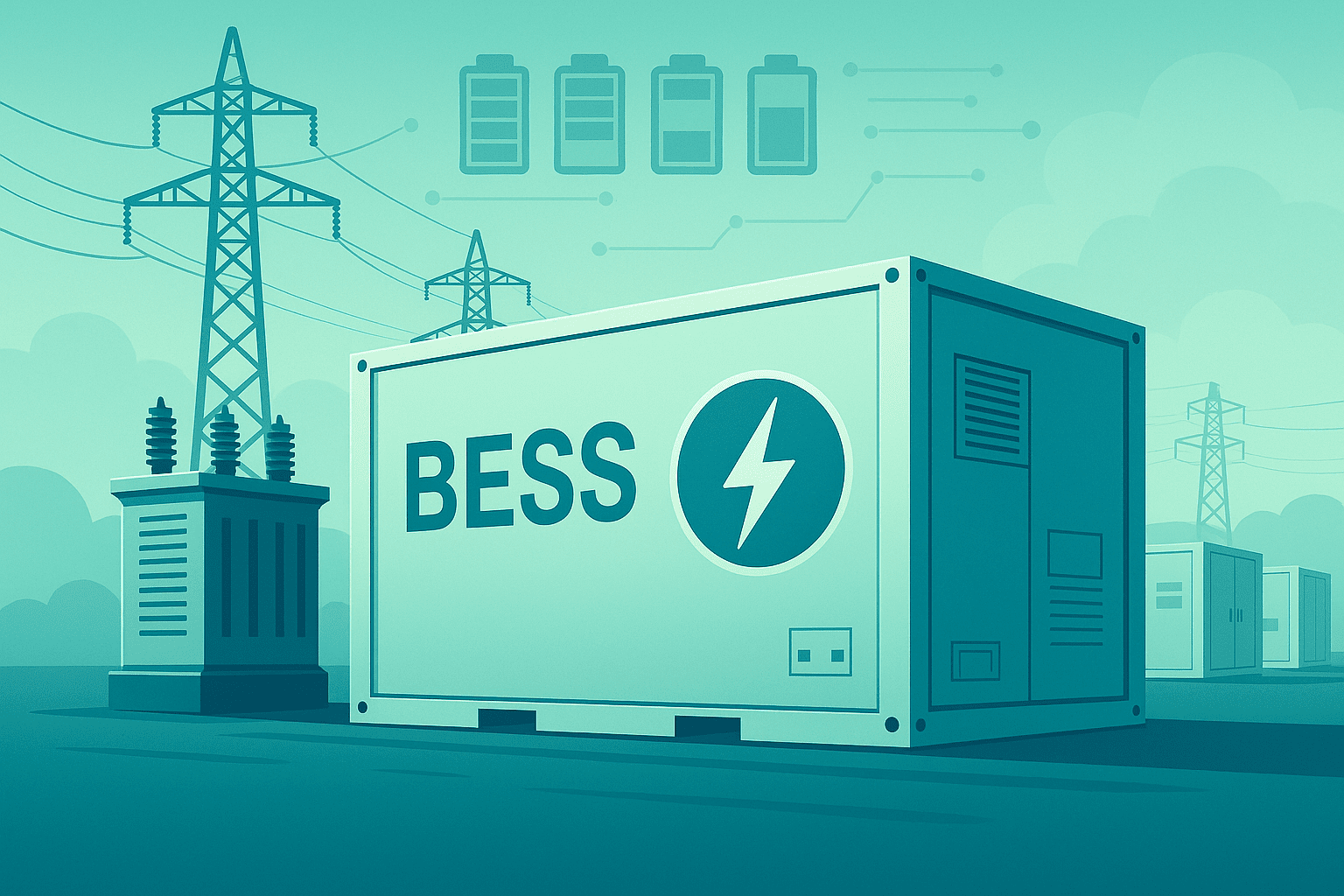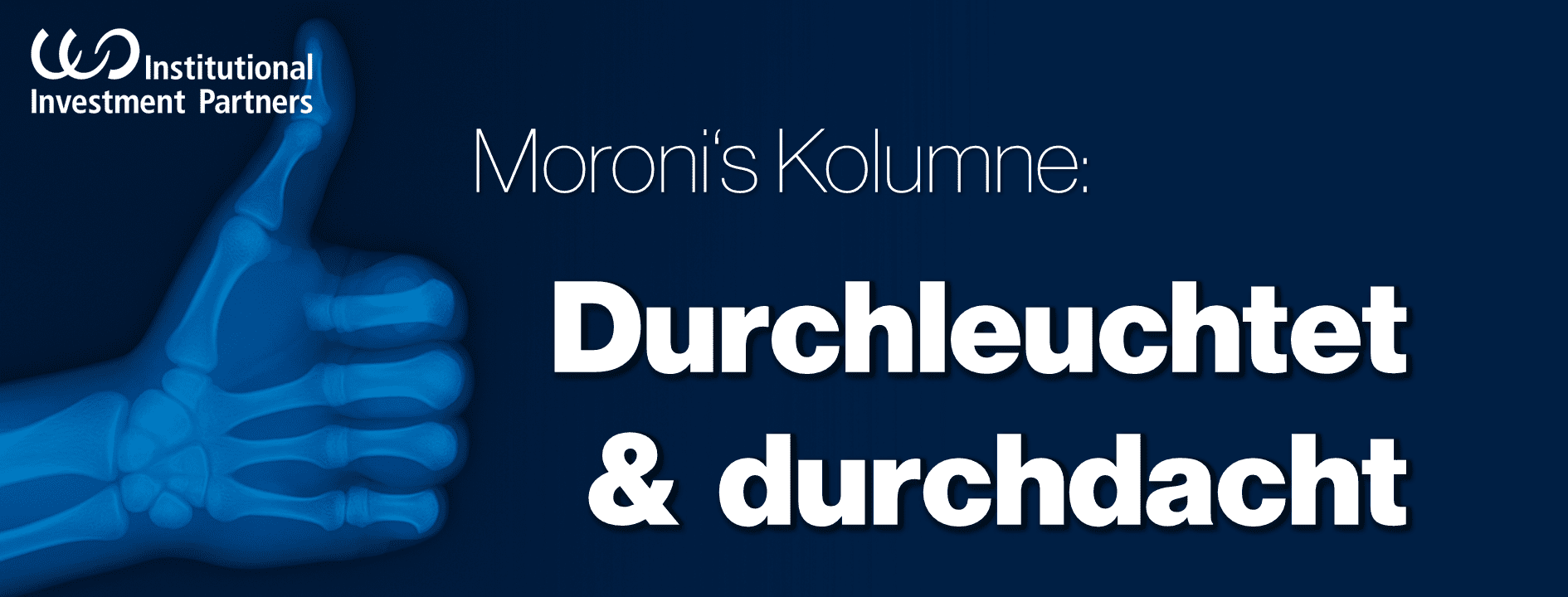
Während die deutsche AnlV Kapitalströme umlenkt, versucht Solvency II, sie risikogerecht zu begleiten. Durch reduzierte Eigenmittelanforderungen soll Kapital insbesondere für Infrastruktur geöffnet werden – Stichwort: qualifizierte Infrastruktur. Am Beispiel der Investition in Großbatteriespeicher-Technologie (BESS) zeigt sich deutlich, dass erfolgreiche Kapitalmobilisierung davon abhängt, Schablonenkriterien wie langfristige, kalkulierbare und vertraglich gut abgesicherte Cashflows bereits im Produktdesign tief zu verankern.
Von der Idee zur Schablone
Solvency II hat keine Infrastrukturquote – aber ein starkes Konzept: qualifizierte Infrastrukturinvestitionen. Der Telos ist klar: Wo Risiken niedriger und Cashflows stabiler sind, darf der Kapitalbedarf der Versicherer sinken. Die aufsichtsrechtliche Logik lautet also: Wer mit Sicherheit investiert, braucht weniger Sicherheitshinterlegung. Doch der Weg dorthin führt über Nachweise, Definitionen und Strukturen, die nicht zufällig entstehen, sondern bewusst im Produktdesign angelegt werden müssen.
Was die Schablone verlangt
Artikel 164 a und b der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 beschreiben ein Idealbild: planbare Cashflows, begrenzter Unternehmenszweck, robuste Verträge, belastbare Governance.
(Während Artikel 164 a auf Infrastrukturprojekte mit klar umrissenen Vermögenswerten und projektbezogenen Verträgen zielt, erweitert Artikel 164 b das Privileg auf Infrastrukturunternehmen – also Betreiber- oder Beteiligungsstrukturen, deren Geschäftstätigkeit sich dauerhaft auf den Besitz, Betrieb oder die Finanzierung solcher Assets konzentriert.)
Diese Anforderungen sollen die ökonomische Stabilität realer Assets in versicherungsaufsichtsrechtliche Sicherheit übersetzen. Wer sich innerhalb dieses Rahmens bewegt, profitiert von einer Eigenmittelunterlegung von rund 22 % statt 39 % – ein Privileg, das für Versicherer unmittelbar investitionsrelevant ist.
BESS – Batterien als interessanter Anwendungsfall
Im Strom- und Regelleistungsmarkt monetarisierbare Großbatteriespeicher (BESS-Anlagen) finden als Infrastruktur-Anlageklasse zunehmend das Interesse institutioneller Anleger – nicht zuletzt wegen Renditeerwartungen im Double-Digit-Bereich.
Technische Einblicke in die Asset Klasse vermittelt der Beitrag von Dr. Andreas Peppel praxisbezogen auf ASSETPHYSICS. Im jüngsten Beitrag ebenfalls von Dr. Andreas Peppel auf dieser Plattform sind die Chancen und Risiken dieser Asset Klasse zusammengefasst.
Der Regulierer will Nachweise – und das Produktdesign muss liefern
BESS-Anlagen weisen per se Charakteristika auf, die im Einzelfall durchaus unter die Solvency-II-Schablone der qualifizierten Infrastruktur fallen können:
- Vorhersehbare Ertragsquellen durch langfristige Pacht- oder Capacity-Agreements mit Operator, Netzbetreibern oder Energiehändlern.
- Begrenzter Unternehmenszweck über projektbezogene SPVs, die ausschließlich Speicher betreiben.
- Technologische Planbarkeit dank modularer Systeme, standardisierter Wartungszyklen und klarer Performance-Klauseln.
- Governance-Stabilität durch Service-Level-Agreements, Versicherungskonzepte und ESG-Monitoring.
Auch wenn die Batteriespeicher-Technologie weitgehend standardisiert ist, unterscheiden sich Fonds danach, wie sie zur Monetarisierung eingesetzt sind. Es reicht daher nicht, nur nachzuweisen, dass BESS-Anlagen langfristig und gut abgesicherte Erträge liefern können. Von Infrastruktur-Fonds typischerweise bekannter Betreiber-Modelle bis hin zu ganz vereinzelt risikoaversen vermögensverwaltenden Ansätzen bildet sich die Monetarisierung von BESS-Anlagen in einem breiten Spektrum ab.
Das ist also bei der Subsumtion genau zu berücksichtigen. Denn – ganz stark simplifiziert – geht es im Kern um die Frage, ob als Regelfall der Solvency-II-Logik die Kapitalgeber durch regulatorische oder vertragliche Bestimmungen in der Nutzung von BESS-Anlagen geschützt sind. Und wenn nicht: Substituiert diesen Schutz dann zumindest, dass die Einnahmen durch die BESS-Anlagen durch Zahlungen einer großen Zahl von Nutzern finanziert sind. Unterschiedliche Monetarisierungs-Ansätze im Fonds verlangen gegebenenfalls verschiedene vertragliche Umsetzungsansätze, um in den Genuss der reduzierten Eigenmittelhinterlegung zu kommen. Wer ist denn im einzelnen Fondskonstrukt Vertragspartner und aus welchen Verträgen entsteht im jeweiligen Einzelfall aus Sicht des Fonds unmittelbar die Monetarisierung, welche Ausschüttungen und Kapitalrückgaben an die Anleger speist?
Warum die Qualifizierung so anspruchsvoll ist
Denn wenn auch in der Theorie es genügt, nachzuweisen, dass ein Investment stabile, langfristige und gut abgesicherte Erträge liefert – in der Praxis verlangt Solvency II verbindlich eine Detailtiefe, die Fondsstrukturen erst einmal abbilden müssen. Die Unterscheidung zwischen Projekt und Corporate (Art. 164 a / b) zwingt zur exakten Abbildung des wirtschaftlichen Zwecks, zur Offenlegung der Vertragsarchitektur und zu konsistenten Cashflow-Prognosen auf Asset-Ebene. Schon kleine Abweichungen – Betreiber, variable Erlösquellen oder Mischportfolios – können die Einstufung beeinflussen. EIOPA hat bereits 2016 im Final Report on CP 16/004 und wiederholt in späteren Konsultationen darauf hingewiesen, dass gerade die Dokumentationspflichten, Datenanforderungen und Look-through-Analysen die praktische Nutzung des Privilegs erheblich einschränken. So bleibt die „qualifizierte Infrastruktur“ oft weniger eine Frage des Risikos als eine des Nachweises.
Daher muss für eine gesicherte Einstufung als qualifizierte Infrastruktur im jeweiligen Fondsdesign das richtige KPI-Set entwickelt werden. Die Praxis zeigt, dass genau hier die Gestaltungsaufgabe guter Produktanbieter liegt: Wer schon im Fondsdesign saubere Datenschnittstellen, transparente Vertragslogik und belastbare KPI-Systeme verankert, verwandelt regulatorische Herausforderungen in Wettbewerbsvorteile.
📌 Ergebnisse
- BESS-Anlagen im Strommarkt unterstützen die Versorgungssicherheit und Netzstabilität.
- Zugleich sind BESS-Anlagen für Solvency-II-Anleger ein interessanter Ansatz, dank Behandlung als qualifizierte Infrastruktur mit geringerer Eigenmittelunterlegung von langfristigen Cashflows zu profitieren.
- Solvency II definiert die qualifizierte Infrastruktur jedoch in engen Grenzen im Sinne einer Schablone, die verstanden und abhängig vom konkreten Fondsdesign richtig ausgefüllt sein will.