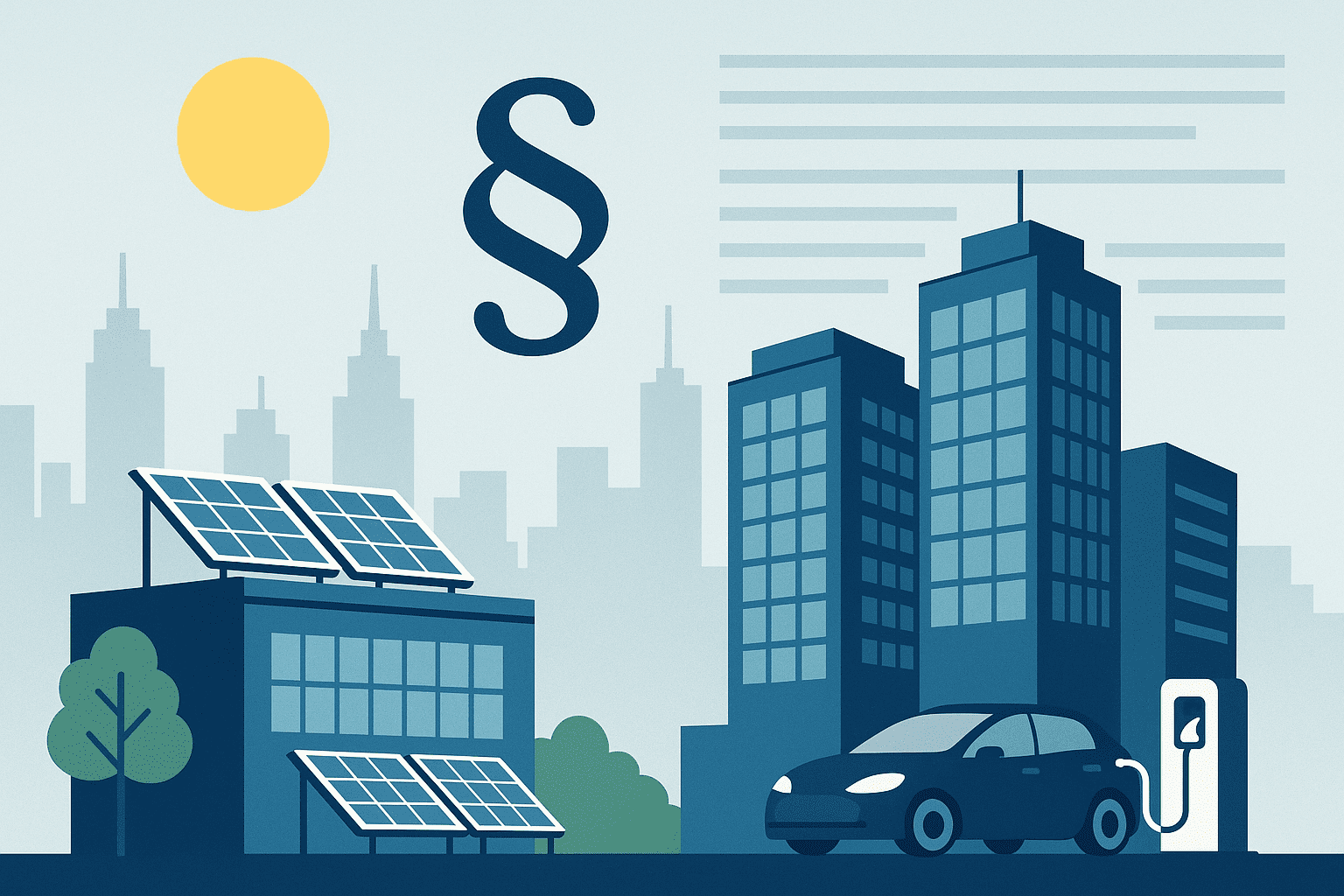Die vormalige deutsche Bundesregierung hat ambitionierte Ziele für die Transformation des Verkehrssektors formuliert: Bis zum Jahr 2030 sollen 15 Millionen vollelektrische Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sein, flankiert von einer Million öffentlicher Ladepunkte. Dieses Ziel impliziert ein Verhältnis von 15 E-Fahrzeugen pro öffentlichem Ladepunkt. Über diesen ambitionierten, aber notwendigen Schritt für den Klimaschutz und die Energiewende im Mobilitätsbereich sprechen Tim Deemann, Director Institutional Sales und Felix Kreppel, Senior Investment Manager Infrastructure Equity, beide MEAG.
TD: Wenn wir auf die Zielmarke von 15 Millionen E-Fahrzeugen bis 2030 schauen – wo stehen wir heute wirklich, auch im Hinblick auf die Investitionsbereitschaft im Infrastruktursektor?
FK: Der Weg zu diesen Zielen gestaltet sich schwierig. Aktuell sind in Deutschland lediglich rund 1,79 Millionen reine Elektro-Pkw zugelassen – nur etwa 14 Prozent aller Neuzulassungen entfallen derzeit auf E-Autos. Zwar wurde im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von etwa 380.000 Fahrzeugen verzeichnet, dieser liegt jedoch rund 27 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Wesentliche Gründe für den Rückgang sind unter anderem der Wegfall staatlicher Kaufprämien, weiterhin hohe Anschaffungskosten sowie eine noch unzureichend ausgebaute und regional unausgewogene Ladeinfrastruktur.
TD: Und wie sieht es in Bezug auf den Ausbau der Ladeinfrastruktur aus?
FK: Die Anzahl öffentlicher Ladepunkte hat sich zwar auf etwa 154.000 mehr als verdoppelt, darunter 33.000 Schnellladestationen. Trotzdem ist der Ausbau regional sehr unterschiedlich. Ein Drittel aller Gemeinden hat noch keinen einzigen öffentlichen Ladepunkt. Rechnet man Plug-in-Hybride mit ein, kommen aktuell etwa 17 Fahrzeuge auf eine Ladesäule – bei Schnellladern liegt das Verhältnis sogar bei 82:1.
Für viele unserer Kunden zählt nicht nur die Rendite, sondern auch Planbarkeit.
TD: Welche konkreten Hürden halten Versicherungen, Pensionskassen oder Versorgungswerke davon ab, stärker in Ladeinfrastruktur zu investieren?
FK: Es gibt mehrere: Der Kapitalbedarf ist hoch, aber die Wirtschaftlichkeit hängt von einer stabilen Auslastung ab. Gleichzeitig steht die öffentliche Infrastruktur im Wettbewerb mit privaten Ladelösungen, die künftig 60 bis 70 Prozent aller Ladevorgänge abdecken könnten. Hinzu kommen regulatorische Hürden, Netzengpässe, lange Genehmigungsprozesse und hohe Betriebs- und Wartungskosten.
TD: Viele sprechen vom Henne-Ei-Problem bei Ladeinfrastruktur. Warum ist das so?
FK: Es geht um die gegenseitige Abhängigkeit: Verbraucher kaufen E-Autos nur, wenn genug Ladeinfrastruktur vorhanden ist – und Investoren investieren nur, wenn die Nachfrage nach E-Autos steigt. Diese Dynamik erschwert Entscheidungen und sorgt für Zurückhaltung auf beiden Seiten.
TD: Und wie ist der Markt für Ladeinfrastruktur strukturiert?
FK: Investoren konzentrieren sich meist auf sogenannte Charging-Point-Operator (CPOs), also Betreiber von Ladestationen. Diese müssen die Infrastruktur nicht zwingend selbst besitzen – Miet- und Pachtmodelle sind ebenfalls gängig. Der Markt ist sehr fragmentiert, neben großen Namen wie Shell, BP oder EnBW gibt es viele regionale Anbieter – oft schon in Investorenhand.
Beim Ausbau von Elektro-Ladeinfrastruktur und E-Mobilität beobachten wir ein klassisches Henne-Ei-Problem.
TD: Beim Ausbau der Elektromobilität spielt die Ladeinfrastruktur natürlich eine zentrale Rolle. Wie lässt sich das Feld sinnvoll strukturieren – und wo kommen die unterschiedlichen Ladeformen typischerweise zum Einsatz?
FK: Grundsätzlich unterscheidet man drei Einsatzbereiche:
1. En-Route Charging (z. B. Autobahnraststätten),
2. On-Street Charging (öffentlicher Straßenraum)
3. Destination Charging (z. B. Supermärkte oder Restaurants)
Diese lassen sich zusätzlich nach Ladeleistung differenzieren: AC-Ladung (<12 kW), DC-Fast Charging (12 bis 149 kW) und High Power Charging (> 150 kW).
TD: Für viele unserer Kunden zählt nicht nur die Rendite, sondern auch Planbarkeit: Ladeinfrastruktur wird dann investierbar, wenn Frequenz, Standort und Betreiberqualität in einem belastbaren Rahmen zusammenspielen. Welche Investitionschancen ergeben sich aus deiner Sicht aktuell in diesem Bereich?
FK: Ladeinfrastruktur ist derzeit kein typisches „Core“-Investment, sondern eher etwas für opportunistische oder Value-Add-Strategien. Renditen von 15 bis 20 Prozent sind realistisch, spiegeln aber auch das Risiko wider – etwa durch unsichere Auslastung, volatile Strompreise oder hohe Anfangsinvestitionen. Interessant sind insbesondere Modelle mit geringem Risiko, etwa durch Stromabnahmeverträge oder Pachtvereinbarungen.
TD: Und welche Standorte und Technologien gelten als besonders attraktiv für Investoren?
FK: En-Route- und Destination-Standorte bieten großes Potenzial – sie haben eine hohe Frequenz und Aufenthaltsdauer. Kunden können das Laden mit Einkaufen oder Essen verbinden. Besonders gefragt ist High Power Charging (> 150 kW), denn schnelle Ladezeiten sind für viele Nutzer entscheidend. Die Technik – zum Beispiel durch 800-Volt-Batterien – macht das zunehmend möglich.
TD: Worauf sollten Investoren beim Erwerb von CPOs achten?
FK: Entscheidend ist die langfristige Sicherung strategisch günstiger Standorte – etwa durch Rahmenverträge mit Supermärkten oder Tankstellen. Auch die operative Leistungsfähigkeit des Unternehmens und die Qualität des Managements spielen eine zentrale Rolle.
TD: Gibt es zusätzliche Hebel zur Steigerung der Rentabilität?
FK: Ja, durchaus. Zusätzliche Erlösquellen sind zum Beispiel:
– Werbeflächen an Ladestationen
– Parkgebühren
– Energiemanagement-Services
– Handel mit THG-Quoten
– Auch technologische Lösungen wie stationäre Batterien oder Solaranlagen können helfen, die Stromkosten zu senken und die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Förderprogramme in Deutschland und der EU leisten ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit.
TD: Welche Rolle spielt die Nutzererfahrung für den Erfolg von Ladeinfrastruktur?
FK: Eine zentrale. Kunden erwarten eine intuitive Bedienung, zuverlässige Verfügbarkeit, transparente Preise und eine gute App-Integration. Anbieter mit starker Marke, guter Standortverteilung und überzeugendem Service haben klare Vorteile im Wettbewerb.
TD: Was sollten institutionelle Investoren beachten, wenn sie sich heute strategisch im Ladeinfrastrukturmarkt positionieren wollen?
FK: Ladeinfrastruktur bleibt risikobehaftet – manche CPOs kämpfen bereits heute mit finanziellen Schwierigkeiten. Dennoch: Wer strategisch investiert, auf Premiumstandorte setzt und ein erfahrenes Managementteam hat, kann erfolgreich sein.