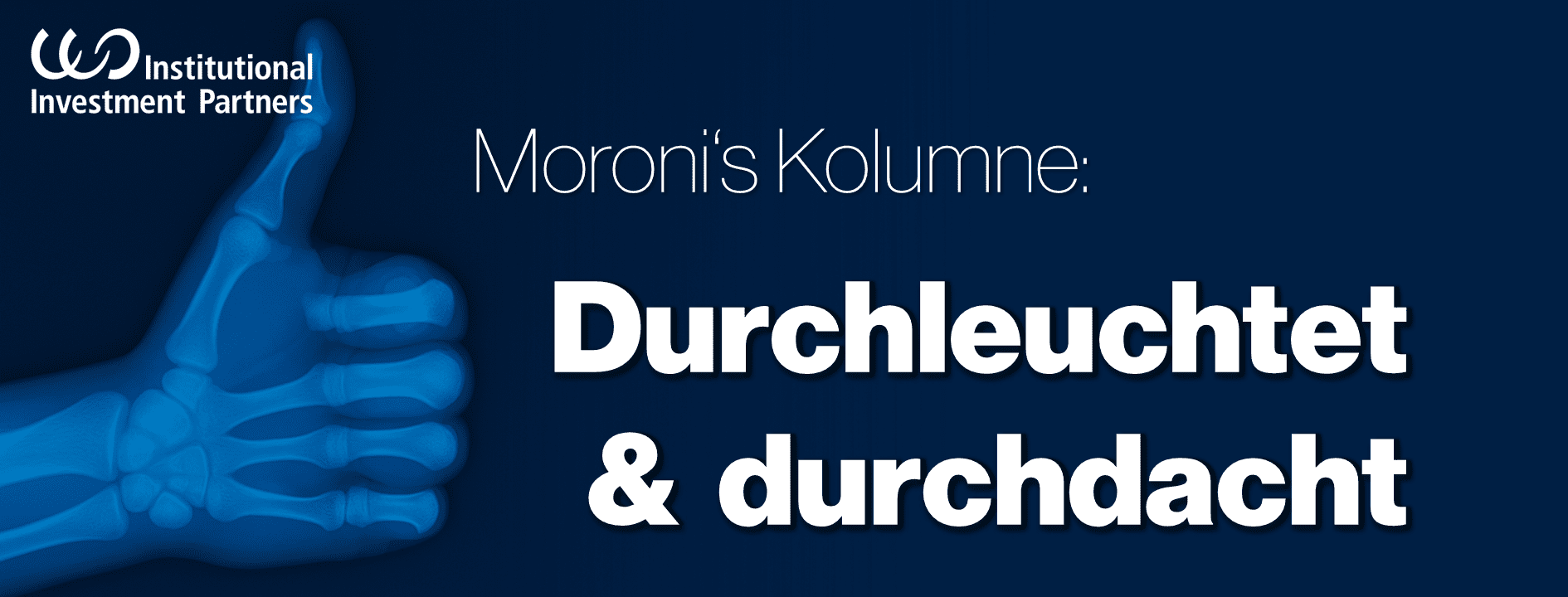
BaFin Konsultation 08/2025 – Entwurf eines Merkblatts […]/2025
Anleger von Spezialfonds zeichnen sich durch ein hohes Maß an Fachkenntnis und Informationsstand aus. Die Einbindung dieses fundierten Fachwissens in die Fondsstrategie eigener gezeichneter Produkte ist möglich, unterliegt jedoch in ihrer konkreten Ausgestaltung bestimmten Grenzen. Ergebnis ist eine Industrie-Praxis, innerhalb der sich eine eingeübte Wechselbeziehung zwischen (semi-) professionellen Anlegern und Kapitalverwaltungsgesellschaft abspielt. Und auf dieser lang entwickelten Praxis wurden in Deutschland Spezialfonds auf sehr effiziente Weise gesteuert. Der Entwurf des BaFin-Merkblatts zur Einflussnahme von Anlegern auf Investments und Desinvestments von Investmentvermögen gibt Anlass, das Verständnis zum überlieferten Rollenspiel mit langer Geschichte von (semi-) professionellen Anlegern und Kapitalverwaltungsgesellschaft zu schärfen.
Anlegermitbestimmung als Teilhabe durch das BaFin-Merkblatt zur Einflussnahme von Anlegern in Investmentvermögen in Frage gestellt?
Anlegermitbestimmung klingt nach einem Kernelement demokratischer Teilhabe. Und tatsächlich lassen sich Parallelen zwischen den im griechischen Stadtstaat Athen nach politischer Mitbestimmung im 5. Jahrhundert vor Christus strebenden Bürgern und ebenso nach fondspolitischer Einflussnahme strebenden (semi-) professionellen Anlegern („Anleger“) von Spezialfonds ziehen: In der antiken athenischen Ekklesia, dem wichtigsten Versammlungsorgan der Bürger hatten die Bürger das Recht, an Entscheidungen teilzunehmen, die die Gemeinschaft betrafen: Themen wie Krieg und Frieden und politische Maßnahmen. Übertragen auf den Spezialfonds betreffen die zentralen Mitbestimmungsrechte der Anleger auch sie unmittelbar berührende, relevante Entscheidungen in Bezug auf ihren Spezialfonds, wie etwa den Erwerb und die Veräußerung von Vermögensgegenständen (Transaktionen), Fondsliquidation und auch Fragen der Ausschüttungspolitik. Als das zur Ekklesia korrespondierende Versammlungsorgan der Anleger von Spezialfonds dürfte man getrost den Anlageausschuss bezeichnen. Und so war nicht nur die Ekklesia in Athen eine exklusive Versammlung für erwachsene Athener Bürger, sondern genauso sind auch heute nur Anleger eines Spezialfonds zur Teilnahme am Anlageausschuss berechtigt oder stimmberechtigt, die sich wie die Bürger Athens durch Einfluss dafür qualifizieren: In der Regel durch die Größe ihres Kapitalanteils am Spezialfonds. Der zentrale Punkt ist, wie die Bürger in der Ekklesia zentrale Mitbestimmungsrechte hatten, die ihnen ermöglichten Einfluss auf die Entscheidungen ihrer Gemeinschaft zu nehmen, so basiert auch bei Spezialfonds das Prinzip auf der Idee der Mitbestimmung und der aktiven Beteiligung der Anlegergruppe im Verhältnis zur den Spezialfonds verwaltenden Kapitalverwaltungsgesellschaft („KVG“).
Das antike Athen ist durch militärische Niederlagen und Eroberungen im Lauf der Geschichte allmählich untergegangen. Droht dem Mitbestimmungsrecht der Anleger gegenüber der KVG und dem Anlageausschuss ein ähnliches Schicksal? Ausgangspunkt dieser Sorge könnte der Entwurf der BaFin zum Merkblatt zum Umfang der aufsichtsrechtlich zulässigen Einflussnahme von Anlegern in Investmentvermögen (GZ: FR 1903/00063#00001) sein.
Worum geht es?
- Das Merkblatt soll Klarheit schaffen, ob und in welchem Umfang die Anleger eines Investmentvermögens Anlageentscheidungen der KVG für Rechnung des Investmentvermögens beeinflussen dürfen. Gegenständlich soll sich das Merkblatt auf „Investitionen“ und „Desinvestitionen“ beziehen. Im Kern verlangt die Aufsicht völlig nachvollziehbar und zu Recht, dass die aufsichtsrechtliche Letztentscheidung bezogen auf die Disposition von Vermögensgegenständen bei der KVG verbleibt (falls das Portfoliomanagement nicht an eine andere Partei ausgelagert wurde)
- Das ist auch folgerichtig, da im Konstrukt des (Spezial-) Fonds die KVG der Regulierung unterliegt. Daraus folgt, dass die BaFin die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben seitens der KVG überwacht; also müssen auch aufsichtsrechtlich die Entscheidungen ausschließlich durch die KVG getroffen werden. Falls nämlich die BaFin feststellt, dass die KVG gegen bestimmte Vorschriften verstößt oder Risiken bestehen, kann sie entsprechende Verwaltungsmaßnahmen in vorderster Linie nur gegen die KVG ergreifen. Kurzum: Eine klare Zuordnung der Entscheidungsverantwortlichkeit ist geboten, damit die Entscheidungen der KVG, als regulierte Einheit, jederzeit der Kontrolle durch die Verwaltung der BaFin unterliegen. In der Praxis dokumentiert die KVG die Letztentscheidung daher regelmäßig in einem eigenständigen Prozess, der zum Beispiel in einer Entscheidung eines (Investment-) Committee mündet.
Mit der Letztentscheidungsbefugnis der KVG kollidieren daher Weisungen von Anlegern in Bezug auf den Erwerb von einzelnen Vermögensgegenständen. Das gilt auch für nicht direkte Weisungen in Form von Vetorechten, da dadurch die Anleger durch Verweigerung ihrer Zustimmung (Veto) die Entscheidung der KVG zur Anschaffung oder Veräußerung eines Vermögensgegenstands blockieren. Nicht mit der Letztentscheidung sollen hingegen „Investmentideen“ oder „Empfehlungen“ der Anleger kollidieren, da insoweit nicht die Letztentscheidungsbefugnis der KVG in Frage gestellt wird.
Worin könnten Probleme liegen?
Bis hierin ist festzuhalten, dass der Merkblatt-Entwurf dogmatisch weitgehend konform mit der bisherigen Industrie-Praxis von Spezialinvestmentfonds zu sein scheint. Es ist bisweilen üblich, und das würde das Merkblatt auch nicht beanstanden, dass vor der Umsetzung relevanter Entscheidungen, insbesondere in Bezug auf den Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen, die Anleger hierzu Empfehlungen abgeben dürfen.
Allerdings: Das Merkblatt hat zusätzliche neue praktische Aspekte zur Konsultation gestellt, die sich insbesondere auf die tatsachenbezogene Umsetzung sowie auf die Dokumentation dieser Umsetzung beziehen würden. Neu wäre es nun, dass kritischer untersucht werden soll, ob es sich im Einzelfall tatsächlich um zulässige Empfehlungen oder gar doch um – unzulässige – Weisungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft handelt. Und zwar soll diese Untersuchung auf quantitativen Merkmalen basieren, wenn die Initiative zur Anschaffung neuer Vermögensgegenstände selten oder nie von der Kapitalverwaltungsgesellschaft selbst, sondern im Wesentlichen und kontinuierlich von den Anlegern ausgeht. Indizien für solche unzulässige indirekte Weisungen sollen sein:
„( … ) wenn der Portfolioverwalter alle Empfehlungen der Anleger Eins-zu-Eins ohne eigene Recherche oder materielle Bewertung der Chance und Risiken des Investments oder Desinvestments ausführt und seine Prüfung formal auf Erwerbbarkeitskriterien oder eine Anlagegrenzprüfung beschränkt“
Es ist nicht bekannt, ob es zu praktischen Versäumnissen in der Industrie kam, welche für die Durchführung der Konsultation zum Merkblatt ursächlich gewesen wären. Allerdings würde die Einführung eines solchen quantitativen Modells mit der Industrie-Praxis brechen. Typischerweise dürfen insbesondere in Anlageausschüssen stimmberechtigte Mitglieder zu jeder Transaktion eine Empfehlung aussprechen, umgekehrt korrespondiert hiermit ihr Recht, dass wirtschaftlich ihr Interesse beachtet wird. Bei spezifischen Asset-Klassen, wie Immobilien etwa, ist dies weitverbreitet. Die KVG könnte sich je Interpretation dieser Restriktion dazu angehalten sehen, immer wieder bei einzelnen Transaktionen von der Kommunikation mit den Anlegern abzusehen. Die Tragweite muss sich vergegenwärtigt werden, wenn man als Beispiel einen Individual-Anleger-Immobilien-Spezialfonds zu Grunde legt, in dem beispielsweise Immobilien mit einem dreistelligen Euro-Millionenwert angeschafft werden. Typischerweise verfügt der Anleger dann selbst über Immobilien-Expertise. Und er hat typischerweise seinen eigenen Individual-Fonds – lediglich – als einen Bestandteil seiner gesamten Immobilien-Kapitalanlage organisiert und ist auch versicherungsaufsichtsrechtlich dazu gehalten, die Investitionen seines Fonds engmaschig und kontrollierend zu begleiten. Es handelt sich um ein austariertes Check-and-Balance-Verhältnis zwischen Anleger und KVG. Quantitative Merkmale höhlen faktisch die Mitbestimmungsrechte von Spezialfonds-Anlegern aus und kollidieren mit eigenen versicherungsaufsichtsrechtlichen Anforderungen. Empirische Gründe hierfür scheinen unbekannt, werden jedenfalls nicht explizit benannt. Jedenfalls würde das nicht die Anforderungen der deutschen Rechtstreuhand beachten:
- Das aufsichtsrechtliche Gebot der Fremdverwaltung, was die Letztentscheidung der KVG bedingt, bedeutet nämlich genau nicht, dass der Wunsch der Anleger außer Acht gelassen werden darf.
- Mit Erwerb der Anteile am Fonds ist zwar der Anleger bezogen auf die aufsichtsrechtliche Ebene Anleger, hat insoweit in seiner Funktion die Letztentscheidung der KVG zu achten und darf ihr daher gegenüber nicht weisungsbefugt zu sein.
- Daneben aber entsteht durch das Abschließen des Fondsvertrags bezogen auf die zivilrechtliche Ebene ein Treuhandverhältnis. Die rechtliche Treuhand ist ein spezifisches deutsches Rechtskonstrukt. Sie ist im deutschen Recht verankert und beschreibt eine besondere rechtliche Beziehung: Der Treuhänder handelt im Auftrag und im Interesse des Treugebers, um bestimmte Vermögenswerte zu verwalten. Dieses Konzept ist in der Vermögensverwaltung etabliert, und gilt daher eigenständig auch im Rahmen der aufsichtsrechtlichen kollektiven Vermögensverwaltung.
Daraus folgt, gleich ob es sich beim Investmentvermögen um ein Sondervermögen oder um ein Investmentvermögen in Gesellschaftsform handelt: Rechtliche Verpflichtung der KVG als Treuhänderin bzw. Geschäftsbesorgerin ist es, die Geschäftsführung im Interesse der Anleger vorzunehmen, dem stets der Vorrang vor allen anderen Interessen einzuräumen ist. Obwohl auf den ersten Blick eine Kollision zwischen der aufsichtsrechtlichen und der zivilrechtlichen Ebene zu bestehen schein, handelt es sich in Wirklichkeit um zwei ergänzende Regelungsbereiche, die unterschiedliche Aspekte abdecken. Bei der Befolgung beider Ebenen ergeben sich nämlich keine tatsächlichen Konflikte, da die jeweiligen Vorschriften unterschiedliche Zielsetzungen verfolgen. Der Vorrang des Anlegerinteresses findet daher aufsichtsrechtlich seine Grenze in der Rechtmäßigkeit des Handelns. Der KVG wäre es nicht gestattet, Anlage-Ideen von Anlegern umzusetzen, wenn diese gegen Recht und Gesetz verstoßen. Eine solche Empfehlung von Anlegern müsste im Ergebnis die KVG daher unberücksichtigt lassen, was völlig zu Recht nicht zu beanstanden ist. Allerdings findet der Vorrang des Anlegerinteresses nicht seine Grenze im Inhalt, d.h. der Wirtschaftlichkeit. Hier greifen die Grundsätze der Rechtstreuhand. Bezogen auf die wirtschaftlichen Aspekte einer Transaktion folgt daraus, dass die KVG unzweifelhaft rechtswidrig handeln bzw. unterlassen würde, dem von Anlegern geäußerten Interesse im Rahmen einer Empfehlung zum Abschluss oder Nicht-Abschluss einer Transaktion nicht zu folgen. Die aufsichtsrechtliche Verantwortung der KVG überlagert oder ergänzt die Interessen der Anleger lediglich insoweit, als die KVG sicherstellen muss, dass
- unterschiedliche Interessen von zwei oder mehreren Anlegern gegeneinander abgewogen werden,
- die Transaktion rechtmäßig ist,
- die inhaltlichen Parameter der Transaktion für die Anleger hinreichend transparent sind,
- die Transaktion ordnungsgemäß durchgeführt wird.
Andernfalls würde die KVG nicht nur gegen die in Deutschland geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen der Treuhand und Geschäftsbesorgung verstoßen, die insofern nicht vom Aufsichtsrecht überlagert werden, sondern sich damit auch unübersehbaren Haftungsrisiken aussetzen, da die Anleger zurecht die Verletzung ihrer Interessen geltend machen könnten. Um das Anlegerinteresse zu ergründen, ist es also praktisch unerlässlich, mit Anlegern zu kommunizieren und durch Empfehlungen zu dokumentieren. Die Einbindungsintensität ist hierbei sehr unterschiedlich, wobei sich ihre Festlegung dem Fondsvertragswerk und gegebenenfalls dieser beigefügten Geschäftsordnung zum Anlageausschuss ergeben kann. Das BaFin-Merkblatt stellt sogar noch weitergehende Dokumentationspflichten bei der Ausübung der Einflussnahme durch die Anleger zur Diskussion. Motiv soll es sein, dass Problembewusstsein für die Einflussnahme durch die Anleger auf die Investition und Desinvestition zu schärfen. Davon will man sich eine Hemmschwelle für unzulässige Einflussnahmen versprechen. Wie vorbeschrieben, ergeben sich jedoch in Ausübung der Rechte aus der Treuhand keine unzulässigen Einflussnahmen, bezüglich derer ein Problembewusstsein zu schärfen wäre. Vielmehr stellt sich die Frage, ob damit die Ausübung eines originären Rechts der Anleger nicht sogar diskreditiert und stigmatisiert wird. Erhöhte Dokumentationspflichten führen zudem zur Rechtsunsicherheit und stünden im Widerspruch mit dem übergeordneten Ziel von Bürokratieabbau.
Empirische Relevanz
Anleger unterscheiden sich – ebenso wie die Asset-Klassen, in die investiert wird. Entsprechend variiert auch das Kommunikationsverhalten von Anlegern gegenüber der Kapitalverwaltungsgesellschaft („KVG“). Während sich ein Teil dieser Anleger nur in begrenztem Umfang zu Anlageideen äußert, steht ein anderer Teil in deutlich häufigerer und inhaltlich intensiverer Kommunikation zur KVG. Besonders betroffen sind die Mitbestimmungsrechte der Anleger von Real Assets Fonds. Bei diesen kommen Portfoliotransaktionen weit seltener vor als bei Wertpapierfonds und sind dann naturgemäß sehr kapitalintensiv, was zu einer erhöhten Abstimmungsrelevanz mit der KVG führt. Frequenz und Tiefe des Austauschs lassen sich dabei typisieren und bestimmten Anlegergruppen zuordnen:
- Anleger-Typus: Versicherungsaufsichtsrechtlich regulierte Anleger kommunizieren ihre Interessen eher deutlich, was einerseits sicherlich mit der Größe ihrer eigenen Kapitalanlage und der damit verbundenen eigenen Expertise zu tun hat. Andererseits darf dieser Kommunikations-Ansatz bereits als Ausfluss einer regulatorischen Pflicht zur Überwachung der Kapitalanlagen aufgefasst werden. Typischerweise gestaltet sich dann die Kommunikation mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft umso intensiver, je größer der vom Anleger gehaltene Kapitalanteil am Spezialfonds ist. Dieser gestaffelte Zusammenhang zwischen Kapitalanteil und Kommunikationsintensität beginnt bei klassischen Vertriebs-Mehranleger-Fonds mit vergleichsweise begrenzter Einbindung in die Fondsstrategie. Hier existieren jedoch Unterschiede, so sind zum Beispiel bei Immobilien-Spezialfonds auch bei klassischen Vertriebs-Mehranlegerfonds Einbindungen der Anleger vorgesehen, die sich auf die Transaktion von Immobilien beschränken können, in manchen Fällen aber auch bereits die Kostenauslösung von Due-Diligence und Fremdfinanzierungen umfassen können. Hier können auch bei Mehranleger-Fonds ursprüngliche Planungen der KVG, die Mitbestimmung der Anleger eher klein zu halten, über den Haufen geworfen werden, wenn die ersten Seed-Investoren Vertreter größerer Kapitalanlagen sind und ihre klaren Vorstellungen in das Fonds-Design mit einbringen. Bei Club-Fonds mit größeren Beteiligungen intensiviert sich der Austausch spürbar. Nicht selten handelt es sich um Single-Asset-Fonds, bei denen die Anleger frühzeitiger und intensiver in Bezug auf den zu erwerbenden Vermögensgegenstand eingebunden sind als beispielsweise bei einer Blind-Pool-Strategie eines klassischen Vertriebs-Mehranleger-Fonds. Existieren also bei einem Club-Fonds oder Mehranleger-Fonds mindestens zwei oder mehrere Anleger, die nicht – beispielsweise, weil es sich um miteinander verbundene Unternehmen handelt, – von vornherein ein einheitliches Interesse verfolgen, muss die KVG sicherstellen, dass Transaktionen stets im Interesse aller Anleger erfolgen. Daher dürfte die KVG beispielsweise nicht der Empfehlung nur eines Anlegers folgen, ohne vorher geprüft zu haben, ob sie wirtschaftlich für das Investmentvermögen geeignet ist oder die anderen Anleger das gleiche Interesse an der Transaktion haben wie der Anleger, der die Anlage-Idee ausgesprochen hat. Typischerweise wird die Manifestation des Interesses über eine Geschäftsordnung des Anlageausschuss organisiert. Die höchste Kommunikationsdichte ist typischerweise bei Individual-Anleger-Fonds zu beobachten, wenn der einzige Anleger sämtliche Anteile am Spezialfonds hält. Mitunter soll dieser Individual-Anleger-Fonds die verlängerte Werkbank in der Kapitalanlage des Anlegers darstellen. Dann hat der Spezialfonds nur einen Anleger, und wenn dieser sein Interesse an einer Transaktion im Rahmen einer Empfehlung klar äußert oder er auf diese Transparenz dokumentiert verzichtet und die Transaktion rechtmäßig ist, so hat die KVG diese Transaktion auszuführen. Insofern werden bei Individual-Anleger-Fonds die konzeptionellen Schwierigkeiten des Merkblatt-Entwurfs besonders deutlich sichtbar: Es wäre wirklich nicht ersichtlich, weswegen dieser einzige Anleger nicht auch ohne formelle Auslagerung auf die Entscheidung der KVG einwirken dürfte, der bei formeller Auslagerung – also im Ergebnis schlicht durch das Hinzufügen eines Vertragswerks – Entscheidungen auch selbst und sogar ohne das Letztentscheidungsrecht der KVG treffen könnte.
- Governance-Typus: Die Ausgestaltung der Kommunikation zwischen Anlegern und KVG ist auch von unterschiedlichen Markt- und Geschäftspraktiken beeinflusst. So verfolgen deutsche Spezialfonds sowie im Ausland aufgelegte, aber gezielt für Anleger aus dem DACH-Raum konzipierte Fondsstrukturen (etwa in Luxemburg) typischerweise einen nicht-diskretionären Ansatz. Das bedeutet: Hier ergibt sich aus der Treuhand eine Einbindungserforderlichkeit der Anleger, die das reine Aufsichtsrecht nicht kennt. Daneben existieren aber durchaus auch diskretionäre Fondsansätze im Spezialfondsbereich, die auf unterschiedliche Gründe zurückgeführt werden können. Jedenfalls kann in diesen Fällen der AIFM, der ohnehin nicht der deutschen Aufsicht unterfällt, im Rahmen der vereinbarten Anlagepolitik weitergehend eigenständig und flexibel Entscheidungen treffen. Beispielsweise ist bei anglo-amerikanischen Fonds eine aktivere Einbindung der Anleger weitaus weniger üblich. Das dürfte vor allem daran liegen, dass dort das aufsichtsrechtliche Verhältnis zwischen Anleger und AIFM in der Regel gerade nicht durch eine zivilrechtliche Treuhand ergänzt wird, weil es sich um ein spezifisch deutsch-dogmatisches Rechtskonstrukt handelt. Und es spielen wiederum auch die verschiedenen Asset-Klassen eine Rolle: Infrastruktur- und besonders Private-Equity-Investments werden typischerweise eher diskretionär zwischen AIFM und Anlegern organisiert. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass hierfür die In-house Kompetenz zur Prüfung jeder Einzeltransaktion nicht durchweg bei jeder einzelnen Anleger-Adresse in einem Ausmaß gegeben ist, die eine intensivere Involvierung zur Entwicklung und Diskussion der Anlage-Ideen sinnvoll erscheinen ließe. Typischerweise liegt dann der Schwerpunkt der Anleger umso stärker in der anfänglichen Manager-Due-Diligence im Rahmen der Produkt-Selektion („Track record“). Sicherlich liegt der Fall bei Immobilien als Asset Klasse ganz anders; typischerweise haben hierzu viele Anleger von Spezialfonds eine fundierte Meinung und umfangreiche Expertise. Wobei auch hier wiederum Unterschiede bestehen, auf welcher Seite der Bilanz der Spezialfonds aktiv ist: Handelt es sich um Real Estate Equity-Strukturen, sind die Spezialfonds eher nicht-diskretionär aufgelegt, handelt es sich aber um Real Estate Debt-Strukturen, verwaltet die KVG den Spezialfonds im Regelfall doch eher diskretionär.
Ergebnisse:
- Es gibt eine aufsichtsrechtliche Beziehung zwischen Anlegern und Kapitalverwaltungsgesellschaft, sowie daneben eine zivilrechtliche, die im deutschen Rechtsraum die sogenannte Treuhand ist.
- Die zivilrechtliche Treuhand ist ein wichtiger Bestandteil, der die Vermögensverwaltung im Rahmen des Treuhandverhältnisses absichert; die damit verbundenen Pflichten und Grenzen des Treuhänders schaffen Transparenz und sorgen für eine stärkere Kontrolle durch die Anleger.
- Daraus folgt, dass die Mitbestimmungs-Rechte der Anleger nicht mit dem aufsichtsrechtlichen Letztscheidungspflichten der KVG kollidieren und nicht inhaltlich und auch nicht durch Dokumentations-Pflichten ausgehöhlt und damit konterkariert werden sollten; das BaFin-Merkblatt war zunächst lediglich als Konsultation ergangen und ein konstruktiver Austausch zwischen Industrie und der Aufsicht hat sich bereits angeschlossen.





