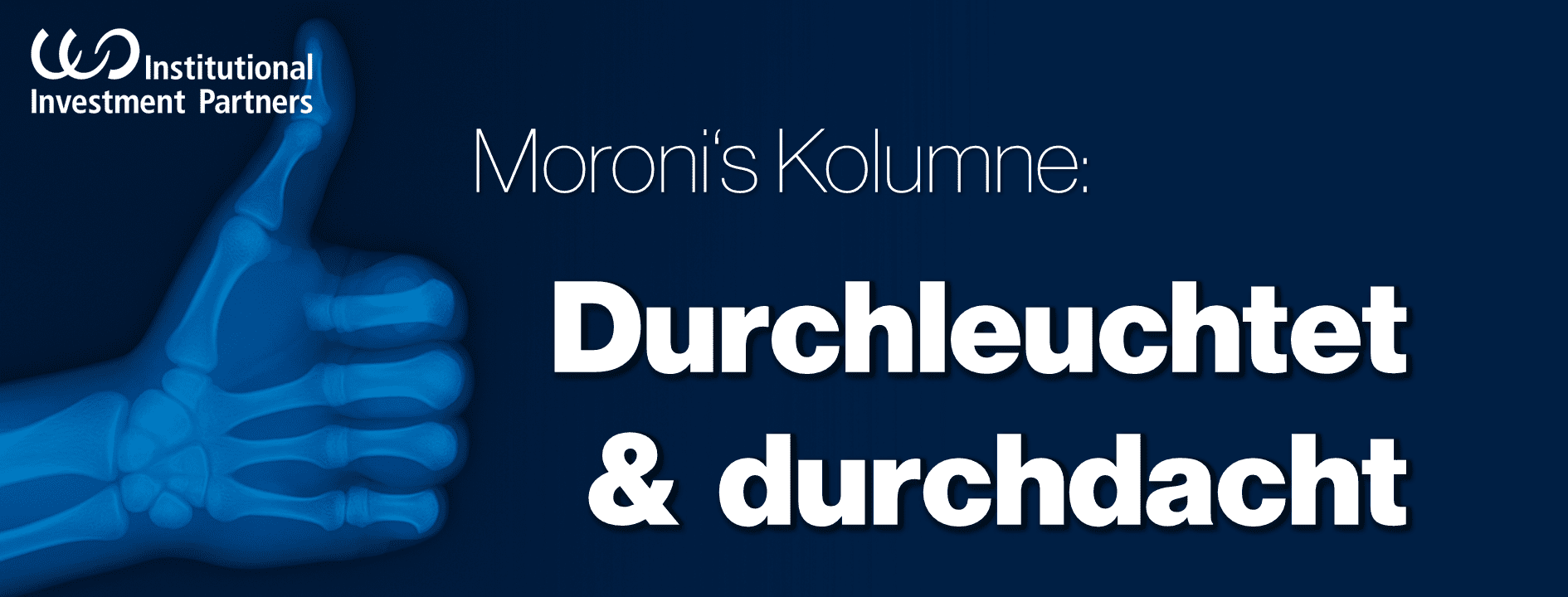
Auf den ersten Blick wirken die neuen Regulatory Technical Standards der ESMA zu offenen, kreditvergebenden Fonds wie eine weitere Lage Aufsichtsschichten – technisch, detailliert, schwer verdaulich. Doch wer genauer hinsieht, erkennt: Diese Regeln sind kein Hemmschuh, sondern eine Architektur der Ermöglichung.
Denn der nun veröffentlichte Final Report der ESMA bündelt nicht nur die Ergebnisse der Konsultation, sondern enthält auch die überarbeiteten Entwürfe der Regulatory Technical Standards (RTS), die nach Berücksichtigung zahlreicher Markteingaben angepasst wurden. Diese RTS-Vorschläge bilden die Grundlage für eine Delegierte Verordnung der Europäischen Kommission, deren Erlass im ersten Halbjahr 2026 erwartet wird. Sie legen fest, unter welchen Bedingungen ein Fonds, der selbst Kredite vergibt, offen geführt werden darf – also Rückgaberechte gewährt, obwohl seine Vermögenswerte langfristig gebunden sind. Es geht um Liquiditätsmanagement, Stresstests, Rückgabepolitiken – kurz: um die Übersetzung illiquider Realwirtschaft in regulierte Fondssprache.
Konkret schreibt das Regelwerk etwa vor, dass Fondsmanager bei der Festlegung ihrer Rückgabepolitik fünfzehn Kriterien berücksichtigen müssen – von der Laufzeitstruktur der Kredite über die Zusammensetzung der Anlegerbasis bis hin zu erwarteten Tilgungsströmen. Der Zweck dieser Aufzählung ist weniger Kontrolle als Kalibrierung: Die Aufsicht will zeigen, welche Stellschrauben Professionalität heute umfasst.
Die eigentliche Botschaft liegt jedoch nicht darin, dass man der Branche nun erstmals illiquide Assets im offenen Mantel zutraut – das gibt es längst, von Immobilienfonds bis zu Infrastruktur-Vehikeln. Neu ist vielmehr der Kontext: Die Aufsicht definiert den offenen Fonds zunehmend als reguliertes System mit eingebautem Risikopuffer. Mit der AIFMD II, die ab April 2026 gilt, wird erstmals verbindlich vorgeschrieben, dass jeder offene AIF mindestens zwei Liquidity-Management-Tools (LMTs) bereithalten muss (Geldmarktfonds nur eines), worüber im Rahmen dieser Kolumne bereits berichtet wurde. Für bestehende Fonds gilt dabei eine Übergangsfrist bis voraussichtlich Frühjahr 2027. Die neuen RTS zu den offenen Kreditfonds sind somit kein Solitär, sondern Teil eines größeren Trends: weg von der Unterscheidung liquid vs. illiquide, hin zu einer Governance-Logik, in der jede Offenheit regulatorisch unterfüttert sein muss.
📌 Ergebnis
- Die Aufsicht zieht die Private-Markets-Welt und damit auch die offenen Kreditfonds in den Regelungskosmos, der bislang den UCITS-Sektor prägte – mit Stresstests, Reporting-Routinen und laufender Überwachung. Die Folge ist eine Konvergenz, die den Markt verändert: Wer langfristige Assets managen will, muss künftig auch kurzfristig Rechenschaft über deren Liquiditätsarchitektur ablegen, bei offenen Kreditfonds ganz besonders.
- Diese Regulierung will nichts verbieten, sie will verlässliche Mechanik In einer Welt, in der Kapitalmärkte immer stärker die Rolle der Banken übernehmen, braucht Offenheit Regeln – nicht guten Willen.
- Auf die Branche kommt eine regulatorische Reifeprüfung Offene Kreditfonds schaffen dauerhafte Plattform-Erträge statt zeitlich befristeter Fondszyklen – aber sie verlangen Professionalität, Disziplin und Vertrauen in Systeme. Dementsprechend wurde im Rahmen dieser Kolumne auch bereits über den Trend zur Konvergenz von KVGs und Kreditinstituten berichtet.
- Nur die etablierten Häuser, die regulatorische mit operativen Prozessen technologisch verknüpfen, können mit einer funktionierender KVG-Governance und glaubwürdigem Liquiditäts-Framework davon profitieren – weil nicht nur Größe, sondern besonders auch operationelle Belastbarkeit entscheidet.





