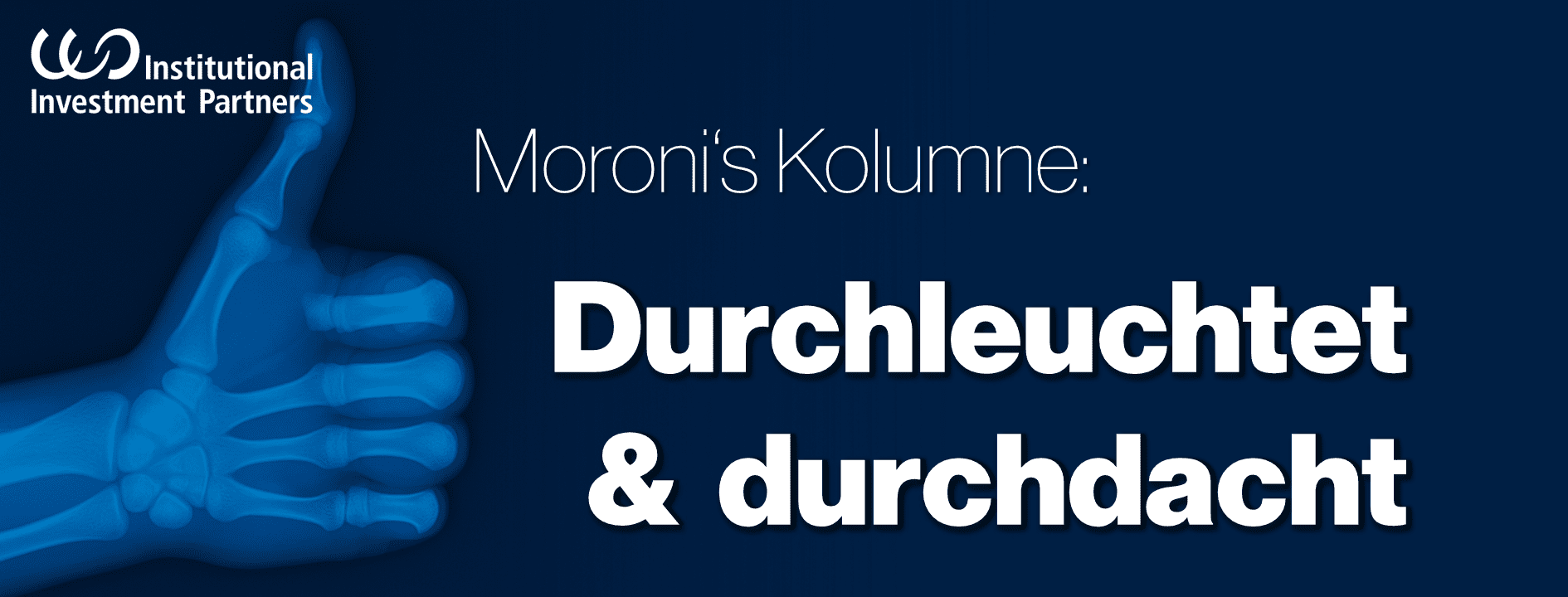
Nach der Veröffentlichung der Kolumne „Mieterstrom aus Photovoltaik: Möglichkeiten und Modelle aus Sicht des Immobilieneigentümers“ haben zahlreiche Rückmeldungen – insbesondere von institutionellen Anlegern – den Autor erreicht.
In diesem Folgebeitrag greife ich gemeinsam mit Henrik Westermann und Frederic Gros von Quartierkraft zentrale Fragen auf und vertiefe ausgewählte Aspekte.
Worum ging es im ursprünglichen Beitrag?
Mieterstrom bezeichnet Strom, der in unmittelbarer Umgebung eines Gebäudes – typischerweise über Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach – erzeugt und vom Betreiber dieser Anlagen direkt an die Mieter verkauft wird. Im ersten Beitrag wurde untersucht, in welchen Geschäftsmodellen Mieterstrom organisiert werden kann und welche Vorteile sich daraus für Eigentümer, Betreiber und Mieter ergeben. Besonders aktuell war dabei die Diskussion über eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH): Hat der BGH das sogenannte Kundenanlagenprivileg grundsätzlich in Frage gestellt oder handelt es sich lediglich um eine Einzelfallentscheidung mit begrenzter Wirkung?
Zur ursprünglichen KolumneFragen von Leserinnen und Lesern
1. Marktgerechte Höhe der Dachpacht
Mehrere institutionelle Anleger, insbesondere solche mit indirekten Immobilieninvestitionen über Spezialfonds, wollten genauer verstehen, welche marktüblichen Pachtspannen für Dachflächen gelten. Das Interesse ist besonders hoch, wenn die Verpachtung innerhalb eines Konzerns erfolgt – etwa wenn eine sogenannte „Vollsortimenter-KVG“ (bei der Asset Manager und KVG personenidentisch sind) an eine eigene Betreiber-Einheit verpachtet.
Antwort: Es kommt auf die Einzelfallumstände an.
Die Höhe der Dachpacht lässt sich nicht pauschal festlegen, kann aber anhand bestimmter Parameter eingeordnet werden:
- Standortbezogene Faktoren: z. B. Sonneneinstrahlung, Verschattung, Strombedarf des Gebäudes (Allgemeinstrom und Mieter), erreichbare PV-Strom Direktverbrauchsquote
- Gebäudebeschaffenheit: Dachart, Dachstatik, Bestandselektrik, Netzanschlussmöglichkeit
- Wirtschaftlichkeitsregel: Je höher die Eigenverbrauchsquote, desto wirtschaftlicher ist die Anlage.
- Skaleneffekt: Kleinere PV-Anlagen haben aufgrund von Fixkosten bei der Installation in der Regel längere Amortisationsdauern als größere PV-Anlagen
Marktindikator:
- Typischerweise liegt die Dachpacht bei ca. 0–4 EUR/m² und Jahr
- Höhere Renditen können erzielt werden, wenn der Eigentümer nicht nur das Dach, sondern gleich die PV-Anlage verpachtet. Dabei trägt der Eigentümer jedoch auch die Investitionskosten. Und: In der Regel ist kein Grundbucheintrag notwendig; die Anlage kann beim Exit als Zubehör mitveräußert werden. Bei vermögensverwaltenden Investmentfonds ist darauf zu achten, dass die Erträge auf Fondsebene nicht der Körperschafts- und Gewerbesteuer unterfallen, was im Einzelfall genauer zu untersuchen ist (z.B. Meidung reiner Umsatzpachten).
- Außerhalb von vermögensverwaltenden Investmentfonds: Die höchste Rendite kann der Eigentümer erzielen, wenn er selbst oder eine zu ihm gehörende Betreibergesellschaft selbst zum Mieterstromanbieter wird. Mit Mieterstrom im Eigenbetrieb sind in der Regel zweistellige Jahresrenditen für den Eigentümer erzielbar. Dabei ist im Einzelfall zu prüfen, wie eine gewerbliche Infizierung beim Eigenbetrieb durch den Gebäudeeigentümer zu vermeiden ist.
2. Berücksichtigung im CRREM-Pathway
Ein weiterer zentraler Punkt betraf die CO₂-Bilanz: Können Eigentümer den auf dem Dach erzeugten PV-Strom auch dann in ihre Dekarbonisierungsstrategie einrechnen, wenn die Anlage dem Betreiber gehört?
Antwort: Ja.
- Das Institut für Immobilienökonomie GmbH (IIÖ) hat bestätigt, dass die auf dem eigenen Dach erzeugte Energie auch im Fall eines Betreiber-Modells (bei Verpachtung der Dachfläche) vom CO₂-Fußabdruck des Gebäudes abgezogen werden kann.
- Hintergrund: Das IIÖ ist Initiator und Weiterentwickler des CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor) und somit die maßgebliche Autorität für diese Frage.
Dies schafft Investitionssicherheit, insbesondere für regulierte Immobilienfonds, die aus steuerlichen oder aufsichtsrechtlichen Gründen nicht selbst oder allenfalls in eingeschränktem Umfang als PV-Betreiber auftreten können.
Weiterführend dazu: GSK Stockmann zur CRREM-Relevanz3. Versicherungsthemen rund um PV-Anlagen
Auch Fragen zu Versicherungen wurden gestellt – insbesondere, wie mit potenziellen Gefahren durch PV-Anlagen auf dem Dach umzugehen ist.
- Der Eigentümer der PV-Anlage ist in der Regel für eine Anlagenversicherung (z. B. Elektronikversicherung für PV-Anlagen) verantwortlich.
- Der Betreiber der Anlage muss eine Betriebshaftpflichtversicherung abschließen.
Fazit: Institutionelle Anleger fordern Transparenz
Mieterstrom kann einen wichtigen Beitrag zur ESG-Optimierung von Immobilien leisten. Gleichzeitig wünschen sich institutionelle Anleger klare Informationen über marktgerechte Bedingungen und transparente Strukturen – insbesondere im Rahmen regulierter Investmentvehikel wie Immobilien-Spezialfonds.




