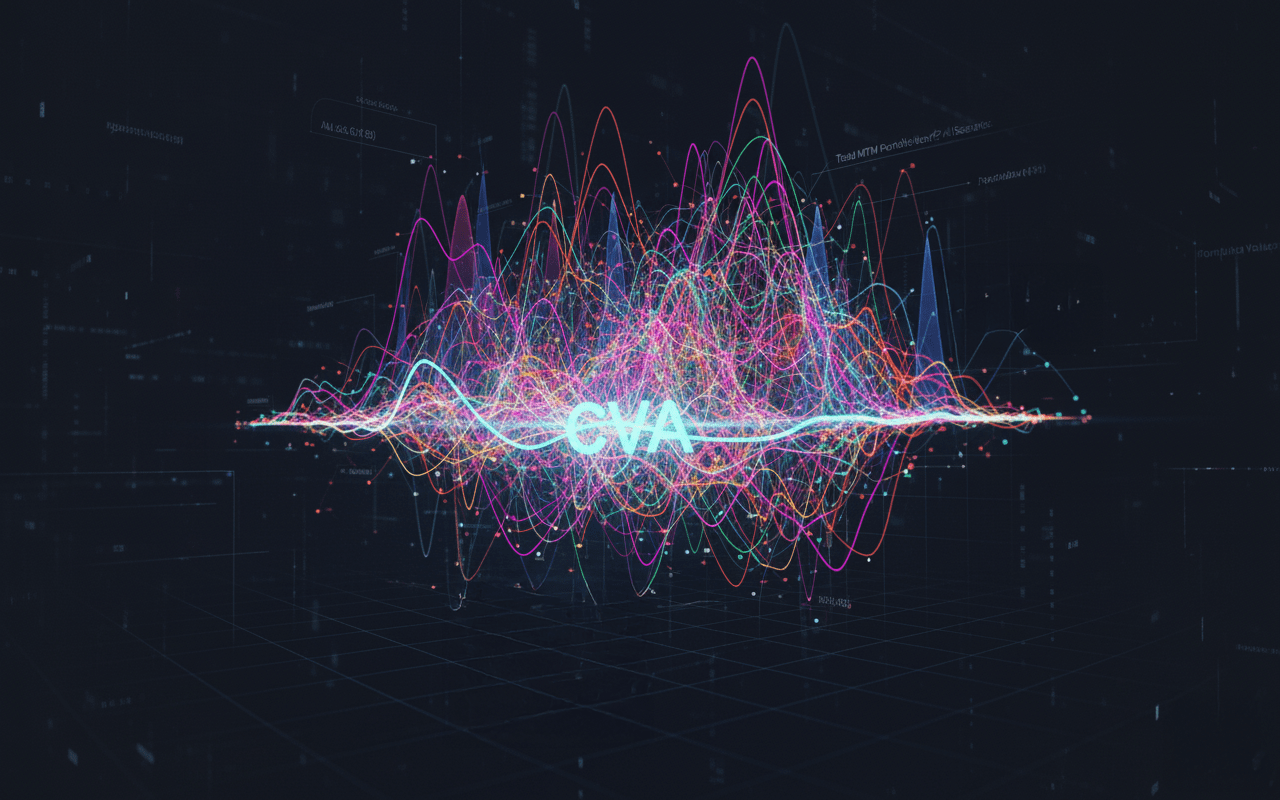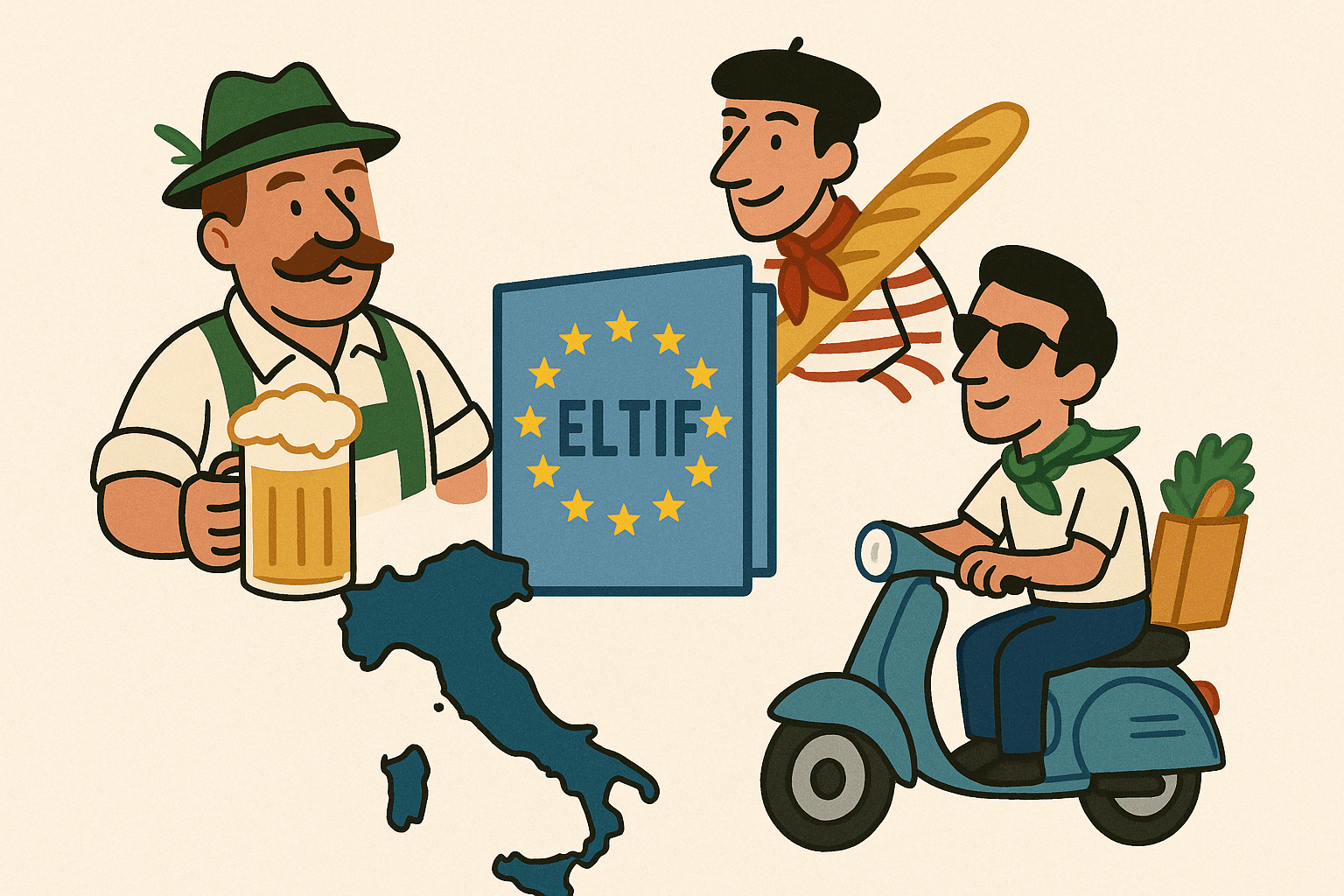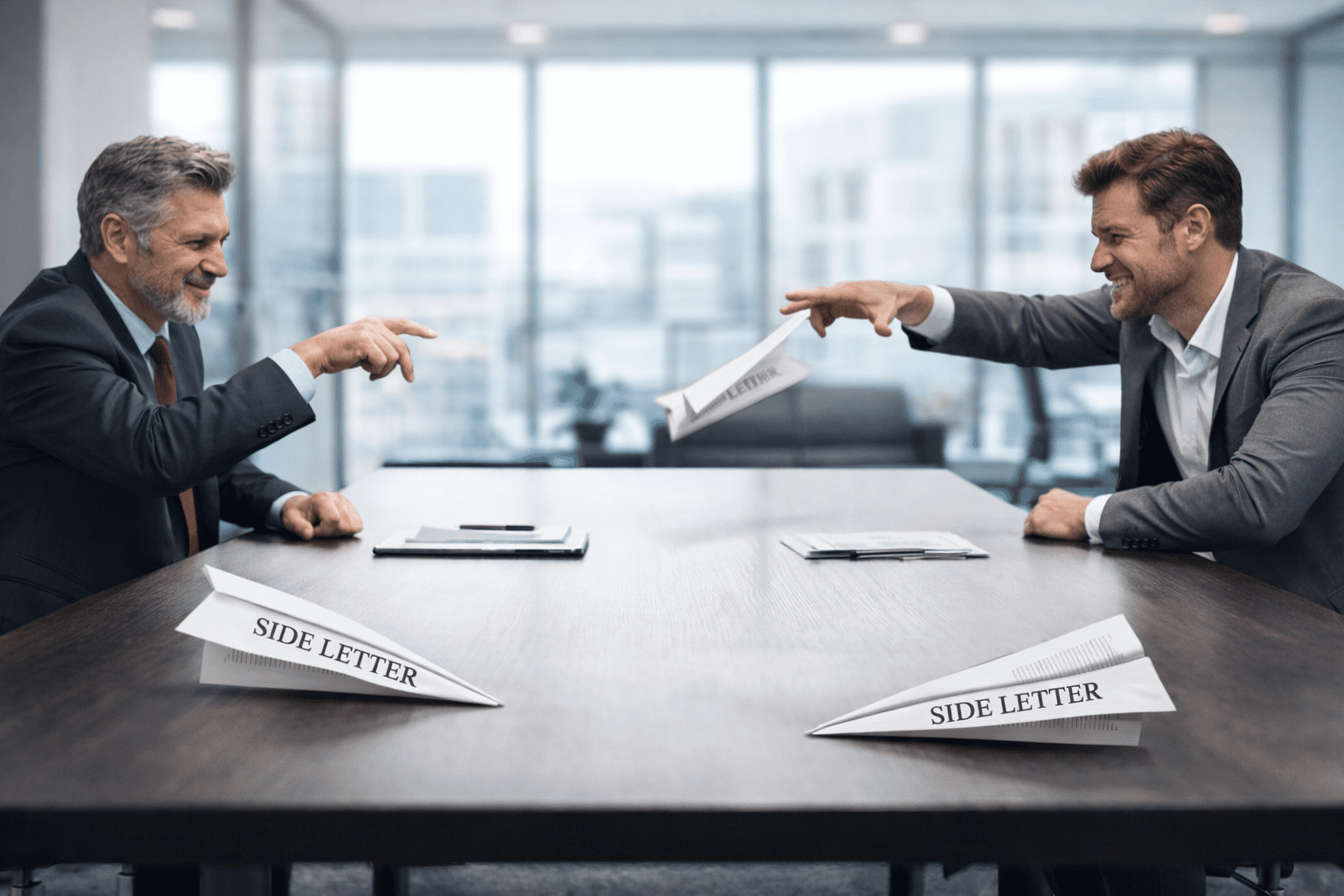Mit der Umsetzung der CRR III zum 1. Januar 2025 rückt das Credit Valuation Adjustment (CVA)-Risiko stärker in den Fokus der Bankenaufsicht. Für Kapitalverwaltungsgesellschaften, die Spezial-AIFs managen und dabei Derivate einsetzen, entsteht daraus eine gesonderte Herausforderung. Sie müssen für CRR-Investoren nicht nur CVA-relevante Daten bereitstellen, sondern zunehmend auch selbst CVA-Risiken berechnen – selbst dann, wenn die Derivate nicht direkt im Fonds, sondern auf Beteiligungsebene gehalten werden oder nur Absicherungszwecken dienen.
1. Neue Anforderungen an die CVA-Berechnung unter der CRR III
Das CVA-Risiko (Credit Valuation Adjustment) beschreibt das Risiko, dass sich der Marktwert eines Derivats aufgrund der Bonitätsveränderung des Kontrahenten verändert. Es handelt sich um eine Anpassung des Bewertungsansatzes, die die potenziellen Verluste aus einem möglichen Ausfall des Kontrahenten berücksichtigt. Historisch wurde das CVA-Risiko erstmals mit der CRR I (Capital Requirements Regulation) im Jahr 2013 als eigenständige Risikoposition eingeführt. Die CRR II brachte 2019 eine erste Weiterentwicklung, insbesondere durch die Einführung des SA-CCR für die Berechnung der Kontrahentenrisiken. Mit der CRR III wird das CVA-Risiko nun deutlich detaillierter und differenzierter betrachtet, insbesondere durch die Einführung des BA-CVA und SA-CVA sowie die Trennung in systematisches und idiosynkratisches Risiko.
Das Systematisches CVA-Risiko bezieht sich auf marktweite Veränderungen der Kredit-Spreads, etwa durch makroökonomische Schocks. Es betrifft alle Kontrahenten gleichzeitig und ist schwer zu diversifizieren. Das Idiosynkratisches CVA-Risiko hingegen betrifft individuelle Bonitätsveränderungen einzelner Kontrahenten, z. B. durch Ratingmigrationen oder unternehmensspezifische Ereignisse. Beide Komponenten müssen separat bewertet und – sofern möglich – durch geeignete Hedging-Maßnahmen reduziert werden. Für die KVG bedeutet das, dass sie nicht nur Transaktionsdaten, sondern auch kontrahentenspezifische Risikoparameter liefern und eigenständig CVA-Berechnungen durchführen muss – auch bei indirekten Derivatepositionen auf Ebene von Zweckgesellschaften oder Beteiligungen.
2. Meldepflichten bezüglich des CVA-Risikos
Die Datenbereitstellung durch die KVG erfolgt in der Regel über Vorlagen von WM-Datenservice, die speziell für Fondsstrukturen angepasst wurden.
In spezielleren Fällen wird allerdings auch auf selbstgestaltete Datenformate zurückgegriffen, z. B. einem gesonderten CVA-Bericht, welcher über die Ergebnisse der Berechnung hinaus, auch die Parameter zur Herleitung beinhaltet. So kann die erfolgte Berechnung durch die KVG transparent nachvollzogen werden.
Die KVG wird damit zum zentralen Datenlieferanten und Recheninstanz für die aufsichtsrechtliche CVA-Ermittlung des Investors – ohne selbst CRR-pflichtig zu sein. Leider sieht das entsprechende Vorlage von WM-Datenservices noch keine Meldung des idiosynkratischen und systematischen CVA-Risikos vor. An dieser Stelle müssen Sie die KVGen (stand jetzt) selbst behelfen und die Daten auf einem individuellen Weg transportieren.
3. Absicherung oder Spekulation? Derivate im Spannungsfeld der CVA-Regulierung
Derivate können in Investmentfonds grundsätzlich zwei unterschiedliche Funktionen erfüllen. Zum einen zu Absicherungszwecken (Hedging) und zum anderen im spekulativen Einsatz (in sog. Trading oder Alpha-Strategien). Zu Absicherungszwecken dienen Derivate der Risikoreduktion. Typische Beispiele sind:
- Zinsswaps zur Absicherung langfristiger Finanzierungen;
- Währungsforwards zur Sicherung von Fremdwährungsrisiken bei internationalen Beteiligungen;
- Inflationsswaps zur Stabilisierung von Cashflows bei Infrastrukturprojekten.
Diese Geschäfte sind meist langfristig, bilateral und konservativ strukturiert. Sie verfolgen keinen Performancezweck, sondern sollen Risiken aus dem Grundgeschäft neutralisieren. Insbesondere in Spezialfonds mit Real Assets werden Derivate zu Absicherungszwecken gehalten. Spekulativ werden Derivate genutzt, um gezielt Marktchancen zu nutzen oder Renditebeiträge zu generieren. Beispiele wären hier:
- Derivate auf Zinskurven oder Credit Spreads ohne zugrunde liegendes Exposure;
- Derivate zur Hebelung von Positionen;
- Strategien mit hoher Umschlagshäufigkeit oder komplexen Strukturen.
Diese Nutzung ist mit einem höheren Risiko verbunden und kann zu signifikanten Markt- und Kontrahentenrisiken führen.
Die CRR III unterscheidet nicht explizit zwischen Absicherungs- und spekulativen Derivaten bei der Anwendung der CVA-Anforderungen. Beide Nutzungsarten unterliegen denselben Berechnungs- und Meldepflichten – unabhängig davon, ob das Derivat zur Risikoreduktion oder zur Renditesteigerung eingesetzt wird. Das führt zu einem Regelungsparadoxon:
Ein konservativer Spezialfonds mit einem einzigen Zinsswap zur Absicherung muss dieselben CVA-Daten liefern wie ein Fonds mit aktiver Derivate-Handelsstrategie – obwohl das Risikoprofil völlig unterschiedlich ist.
4. Aufsichtszweck vs. operativer Aufwand
Die Zielsetzung der Aufsicht ist nachvollziehbar. CVA-Risiken sollen realistisch und risikosensitiv abgebildet werden. Gerade in Stressphasen können Spread-Änderungen erhebliche Auswirkungen auf die Bewertung von Derivaten haben. Die neue Methodik erhöht die Transparenz und Vergleichbarkeit zwischen Instituten. Für die KVG bedeutet das jedoch vor allem 3 Mankos
- Technischer Mehraufwand: Derivatebuchhaltung muss um Risikodaten ergänzt werden;
- Organisatorische Komplexität: Abstimmung mit Verwahrstellen, Datenlieferanten und Investoren;
- Regulatorische Nähe: Obwohl nicht selbst CRR-pflichtig, wird die KVG Teil der aufsichtsrechtlichen Infrastruktur, die auch geprüft werden kann.
Insbesondere bei Real-Asset-Fonds mit wenigen, konservativen Derivaten erscheint der Aufwand unverhältnismäßig. Die Daten sind oft nicht standardisiert verfügbar, und die Modellierungsmöglichkeiten auf Fondsebene begrenzt.
5. Fazit: Verhältnismäßigkeit wahren
Die neue CVA-Systematik unter CRR III ist aus Sicht der Finanzstabilität sinnvoll. Sie verfolgt das Ziel eine risikosensitive und transparente Abbildung von Kontrahentenrisiken im Derivategeschäft. Für systemrelevante Institute mit umfangreichen Handelsbüchern ist das ein sinnvoller Schritt. Für KVGen mit Spezial-AIFs stellt sie jedoch eine erhebliche operative Belastung dar – ohne dass der tatsächliche Risikoerkenntnisgewinn immer im Verhältnis steht. Eine differenzierte regulatorische Behandlung wäre insofern sachgerecht und würde dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit besser entsprechen. Mögliche Ansätze wären:
- Erleichterungen oder Ausnahmen für klar dokumentierte Hedging-Derivate;
- Pauschale CVA-Risikogewichte für standardisierte Absicherungsgeschäfte;
- Eine nachweisbasierte Differenzierung, z. B. durch Hedging-Dokumentation oder Positionsabgleich mit Grundgeschäft.
Anderenfalls könnten solche Regulierungen dafür Sorge tragen, dass eigentlich sinnvolle Maßnahmen zum Schutz der Anlagen, in Anbetracht des damit verbundenen Aufwandes sinnlos werden.