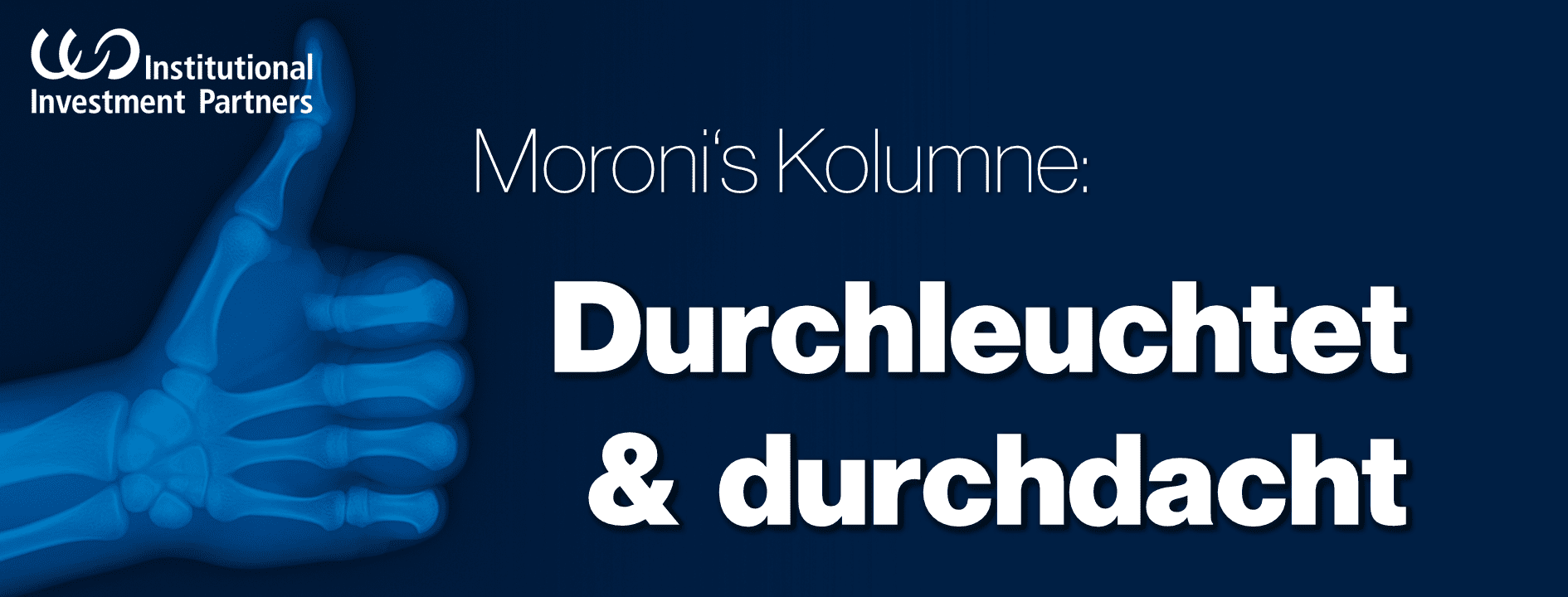
Diese Kolumne überdauert bereits 23 Wochen in Folge. Ein Anlass, darüber nachzudenken, dass sich in 23 Wochen in der Real-Assets-Welt erstaunliche Projekte realisieren lassen – wenn es nur nicht so unverhältnismäßig lange dauern würde, die dafür erforderlichen Mittel heranzuschaffen. Ist die Fondsindustrie ein anachronistisch arbeitender Verhinderer?
Projektspeed in Realwirtschaft
In 23 Wochen lässt sich Erstaunliches bauen.
VolkerFitzpatrick hatte für Royal Mail im nordenglischen South Shields ein neues Delivery Office errichtet – inklusive 1.200 Quadratmeter Neubau, Büroflächen, Yard und PV-Anlage. Programm: 23 Wochen.
Die University of Oxford ließ am Richard-Doll-Gebäude bauliche Anpassungen mit einem klar definierten 23-Wochen-Programm umsetzen.
Und in Melbourne wurde das neue 6.250-Quadratmeter-Headquarter der Kanzlei Maddocks – inklusive Barista-Bar, Wintergarten und hochwertigen Arbeitswelten – in einem 23-Wochen-Programm realisiert.
23 Wochen – oder, eher nebenbei, der Zeitraum, über den diese Kolumne inzwischen durchläuft. Und wenn man sieht, was sich in dieser Zeit im echten Leben errichten lässt, wirkt so manche Fondsgeburt, die nichts anderes als eine Abfolge von wenigen Rechtsakten auf dem Papier ist, erstaunlich langsam.
Strukturträgheit in der Fondsindustrie
Wer Fonds in der Praxis strukturiert und Fondsauflagen begleitet, der weiß: Zwischen ersten Ideen und erstem Kapitalabruf vergehen selten weniger als neun Monate, häufig eher zwölf und durchaus auch mehr.
Nicht, weil niemand arbeitet, ganz im Gegenteil. Sondern weil jede Strukturierungsschicht – KVG-Auswahl, Vehikel, Anlagebedingungen, ESG-Konzept, steuerliche und versicherungsaufsichtsrechtliche Einwertung, Freigaben, Abstimmung von Verträgen mit Fondsdienstleistern und Asset Managern, sorgfältig dokumentiert, abgestimmt sein muss.
Während also „draußen im echten Leben“ Projekte in 23 Wochen stehen, stockt die Fondswelt. Die Realwirtschaft skaliert ihr Tempo, die Fondsindustrie hält an Abläufen fest. Die Fondsindustrie entfernt sich ein ganzes Stück weit von der eigentlichen Wertschöpfung: Für die Allokation von Kapital für Projekte im echten Leben eine schlichte Hülle anzubieten.
Raketen stehen an der Rampe, Treibstoff-Konvoi aber im Stau
Kapital wird in der Realwirtschaft heute schneller benötigt als unsere Fonds-Strukturen es typischerweise zur Verfügung stellen:
- Energie- und Infrastrukturprojekte, deren Ausschreibungsfenster eng und deren Transformationswirkung hoch ist.
- Logistik- und Dateninfrastruktur, die in Monaten hochgezogen wird und dann sofort leistungsfähig sein muss.
- Immobilienprojekte, bei denen Zeitverzug unmittelbar Kosten, Opportunitäten und Standortqualität frisst.
Parallel dazu sehen wir in anderen Branchen:
Kreditprozesse, Zahlungsverkehr, Handels- und Lieferkettensteuerung, Risiko- und Betrugserkennung – alles hochkomplex, hochreguliert und trotzdem zunehmend digital, standardisiert, KI-gestützt, mit Entscheidungszyklen in Tagen statt in Quartalen.
Vor diesem Hintergrund wirkt ein einjähriger Standard-Vorlauf zur Fondsauflage nicht mehr wie Ausdruck überlegter Besonnenheit, sondern wie ein Systemrest aus einer langsameren Zeit.
📌 Ergebnisse und Konsequenzen:
- Zwischen Projektspeed und regulatorischer Viskosität klafft eine Lücke, durch die Kapital im schlimmsten Fall zu spät kommt. Das ist nicht nur ein Branchenthema, sondern eine wirtschaftspolitische Frage, wenn Kapital Projekte nicht erreicht.
- Wie finanzieren wir Energiewende, Infrastruktur, Digitalisierung, Gesundheitsimmobilien und Versorgungssysteme, wenn der zentrale Kanal für langfristiges Kapital strukturell zu langsam arbeitet?
- Die Antwort liegt nicht nur in „weniger Regulierung“, sondern in ihrer besseren Organisation:
- Stärkere Prozess-Basierung statt repetitiver Sonderlösungen,
- vereinfachte, digitale Prozesse
- durch technologische Abbildung sicher anwendbar
Die Fondsindustrie investiert in Assets, die ihrerseits permanenten Innovations- und Anpassungsdruck ausgesetzt sind und diesen auch meistern. Marktteilnehmer in der Fondsindustrie müssen sich daher noch viel stärker selbst hinterfragen, wie sie die Kapitalversorgung besser organisieren könnten und damit ebenfalls ihren Beitrag leisten. Sonst ist es kein Ruhmesblatt für die gesamte Branche, die beansprucht, das Rückgrat langfristiger Finanzierung zu sein.




